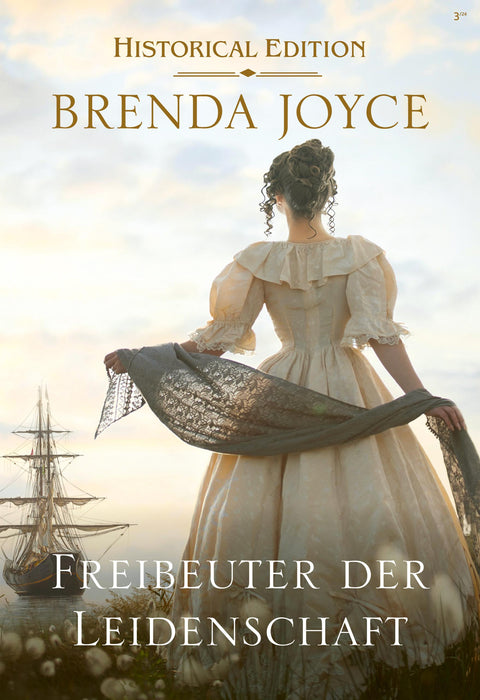
Freibeuter der Leidenschaft
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Was für eine Frau! Statt damenhaft kokett ein Sonnenschirmchen in der Hand zu schwenken, fordert Amanda ihn mit dem Degen heraus. Clive de Warenne kann seinen Augen kaum trauen. Aber er hat versprochen, die aufreizend begehrenswerte Piratentochter zu ihrer Mutter nach England zu bringen. Als ehrenhafter Freibeuter steht er zu seinem Wort, bringt ihr sogar die Manieren einer Lady bei, um ihr den Einstieg in die vornehme Gesellschaft zu ebnen. Er selbst sieht sich keinesfalls als passenden Heiratskandidat – bis Amanda ihr Debüt gibt. Und eine so bezaubernde Ballkönigin ist, dass jeder Mann in ihrer Nähe ihn vor Eifersucht brennen lässt …












