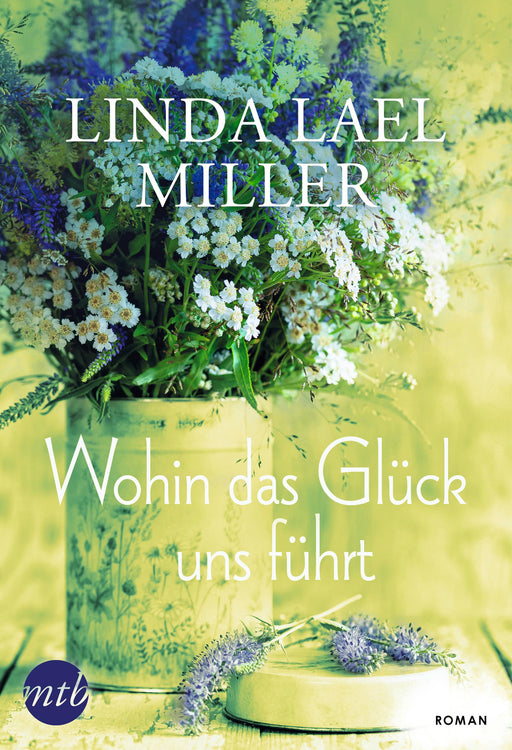In einer zärtlichen Winternacht
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
2 Romane in einem Band!
Ein Cowboy zum Verlieben:
Montana, 1910: Als ihre kleine Schule geschlossen wird, steht Juliana praktisch auf der Straße. Dankbar folgt sie Lincoln Creeds Einladung, einige Tage auf seiner Ranch zu wohnen. Mit seinem überraschenden Heiratsantrag versetzt er ihr Herz in Aufruhr. Denn er macht keinen Hehl daraus, dass er vor allem eine Mutter für seine kleine Tochter sucht. Von Liebe kein Wort. Wie tief Juliana für ihn empfindet, ahnt er nicht...
Hör auf die Stimme deines Herzens:
Brad O'Ballivan ist auf seine Ranch zurückgekehrt! Die Nachricht trifft Meg wie ein Schlag. Vor Jahren war sie mit ihm verlobt. Doch dann zog es ihn nach Nashville - und er wurde als Countrysänger ein Star. Plötzlich steht Brad wieder vor ihr - er scheint fast unverändert. Genau wie ihre Gefühle für ihn. Aber ihr McKettrick-Stolz ist größer als die Sehnsucht. Noch ist sie nicht bereit, ihm zu verzeihen...