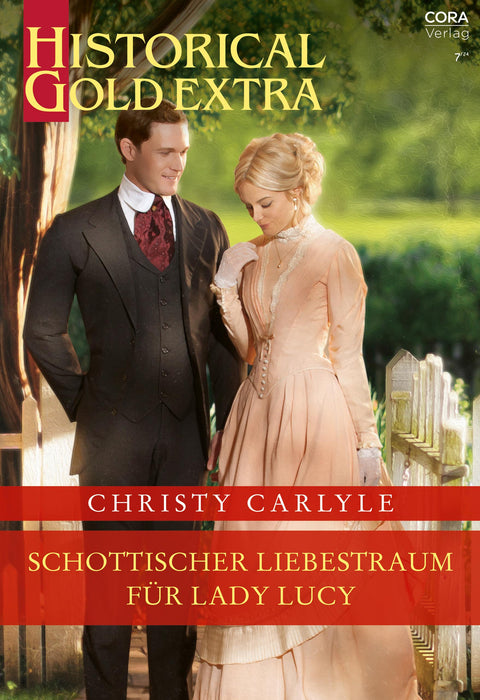
Schottischer Liebestraum für Lady Lucy
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Aufgeregt besteigt Lady Lucy den Zug Richtung Invermere in Schottland – die erste Urlaubsreise ihres Lebens! Bei der Begegnung mit einem schäbigen Wüstling kommt ihr zum Glück der gut aussehende James Pembroke, Earl of Rossbury, zu Hilfe. An seiner Seite kann sie sicher und entspannt reisen, und der Abschied am Bahnhof fällt ihr schwer. Doch bei der Ankunft in ihrem Ferienhaus wartet eine Überraschung auf Lucy: Das Haus gehört ihrem Retter! Gemeinsam verbringen sie viel Zeit in der wildromantischen Landschaft Schottlands. Lucy träumt schon von zärtlichen Küssen des Earls, doch dann erfährt sie, warum er überhaupt angereist ist …











