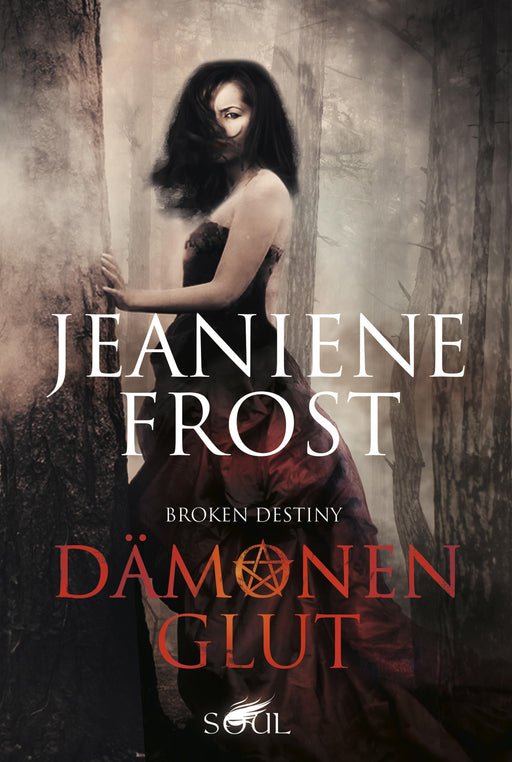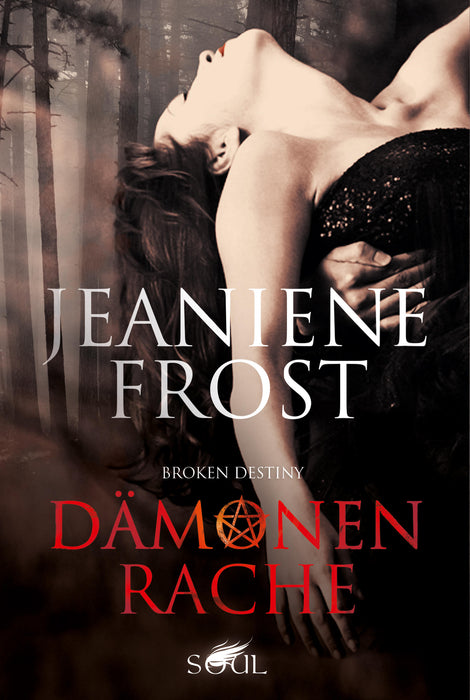
Dämonenrache
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Die Grenzen zwischen der Menschenwelt und den dunklen Reichen fallen schneller als befürchtet, außerdem wird die Auserwählte Ivy nach ihrem Etappensieg über die Mächte der Finsternis von rachsüchtigen Dämonen gejagt. Notgedrungen tut sie sich erneut mit Adrian zusammen, obwohl er sie verraten hat. Sie weiß nicht, was schwieriger ist: die heilige Waffe zu finden, mit der die Dämonen in ihre Schranken gewiesen werden können. Oder ihrem gefährlich attraktiven Verbündeten zu widerstehen. Zumal der wild entschlossen ist, sein Schicksal, das ihn zu ihrem Todfeind bestimmt hat, zu überwinden und ihre Liebe zurückzugewinnen - auch wenn er dafür Himmel und Hölle herausfordern muss …
"Ich öffne jedes neue Frost-Buch in freudiger Erwartung und werde niemals enttäuscht."
Bestsellerautorin Charlaine Harris
"Eine Geschichte voller Leidenschaft, dunkler Sinnlichkeit und rasanter Action"
Bestsellerautorin Kresley Cole
"Wildromantisch und voller Action"
RT Book Reviews
"Jeaniene Frost gehört auf jede Must-Read-Liste"
New York Times-Bestsellerautorin Lara Adrian
"Eine spannende neue Welt"
Publishers Weekly
"Ein weiteres aufregendes Abenteuer."
Romance Reviews Today
"Der atemberaubende Mix aus Urban Fantasy und Love-Story ist einfach phänomenal."
Romantic Times