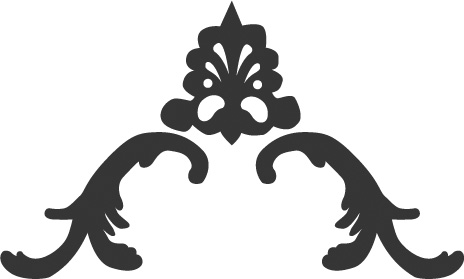Deluxe Dreams
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Ein legendäres Modeimperium, eine Familie, umgeben von dunklen Geheimnissen, und eine Liebe, so tief und echt …
Ihre Rucksacktour führt Sadie an die Riviera, doch sie erlebt Nizza nicht von der Sonnenseite. Als sie überfallen wird, eilt ihr ein attraktiver Fremder zu Hilfe. Ihr Retter ist Olivier Dumont, der begehrteste Junggeselle Frankreichs und Erbe des Modeimperiums. Olivier zieht sie in seinen Bann – und in eine Welt voller Glamour, Luxus und Leidenschaft. Er erfüllt ihr all ihre Träume und erobert ihr Herz. Schon bald jedoch muss Sadie erkennen, wie zerbrechlich ihr Glück ist. Denn hinter der glitzernden Fassade der Dumont-Dynastie lauern Abgründe und Gefahren, die ihre und Oliviers Liebe für immer zerstören könnten …
Der mitreißende Auftakt der »Dumont«-Saga