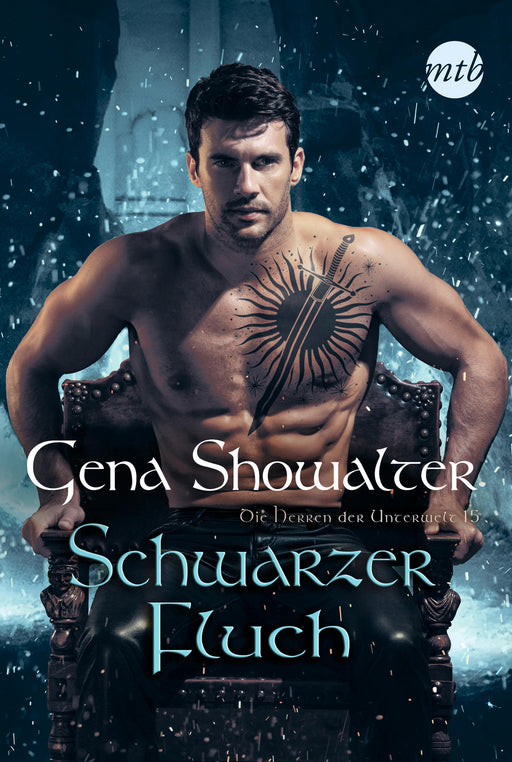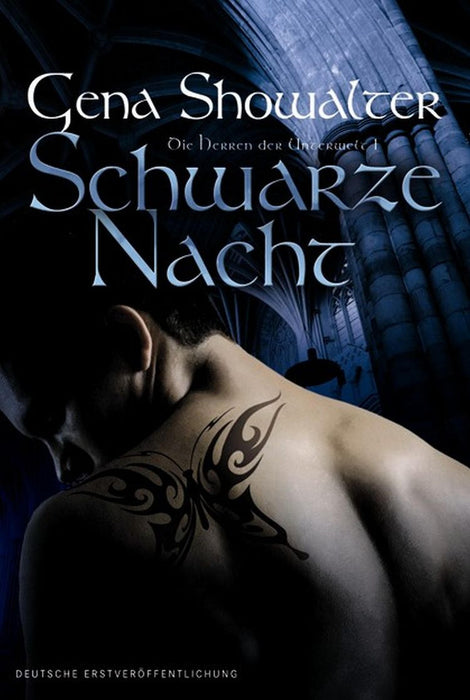
Die Herren der Unterwelt 1: Schwarze Nacht
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Einst dienten die tapferen Lords der Unterwelt dem Gottkönig. Ein Zwist aber führte dazu, dass die zwölf Ritter mit einem Dämon bestraft wurden, den sie jeden Tag aufs Neue zu bezwingen haben ...
Die junge Wissenschaftlerin Ashlyn Darrow ist verzweifelt: An jedem Ort hört sie alle Gespräche, die je dort stattgefunden haben. Und sie weiß: wenn, dann können ihr nun die Lords der Unterwelt helfen. Auch auf die Gefahr hin, von den Unsterblichen getötet zu werden, wagt sie die Reise zum Haus der Verdammten - und trifft in den Wäldern vor den Toren Budapests auf Maddox, den Hüter des Dämons der Gewalt. Zum ersten Mal verstummen alle Stimmen in ihr.
Auch Maddox spürt sofort den unwiderstehlichen Reiz der jungen Amerikanerin. Doch er darf seinen Gefühlen nicht nachgeben, denn das Böse in ihm ist unberechenbar. Ein jahrtausende alter Kampf entflammt von Neuem: gegen den inneren Feind, und gegen den äußeren, der Ashlyns Spur verfolgt hat. Beide wollen nur eins: töten! Maddox' und Ashlyns Schicksal scheint besiegelt.