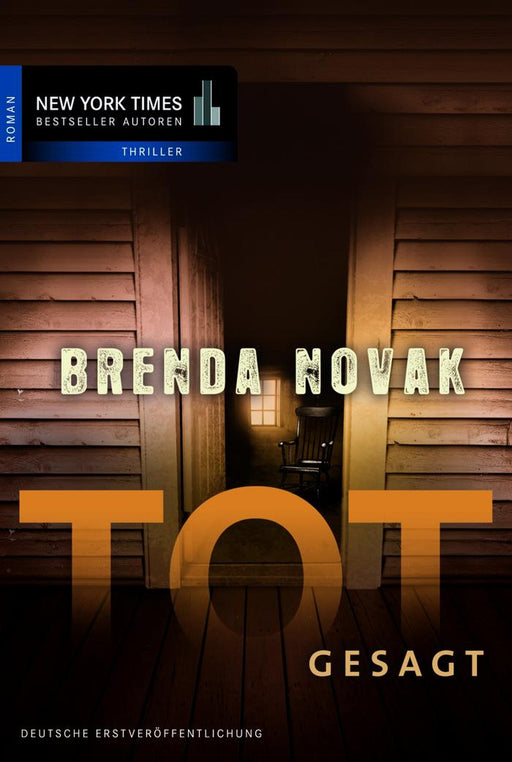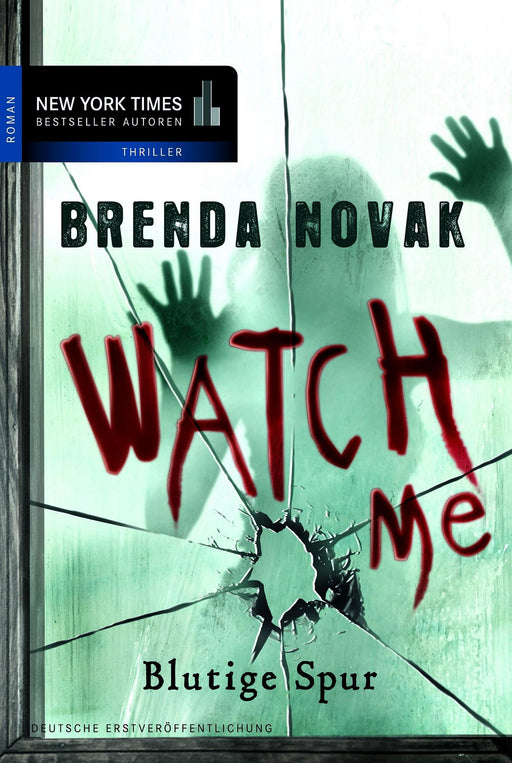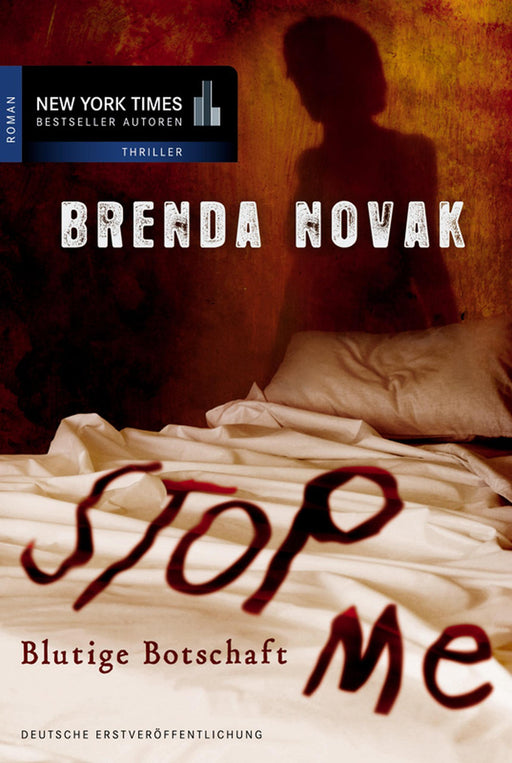Die Stillwater-Triologie
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
TOTGESCHWIEGEN
Ein Grab liegt hinter dem Farmhaus am Mississippi. Nur drei Menschen wissen, wer der Tote darin ist ... Grace Montgomery ist eine von ihnen. Weit weg von der Kleinstadt Stillwater mit ihren grausamen Erinnerungen hat sie als Staatsanwältin Karriere gemacht. Aber jene Mordnacht lässt sie nicht los: die Schreie, das Blut, der Kampf, die Todesstille. Um endlich aus dem düsteren Schatten der Vergangenheit zu treten, kehrt Grace jetzt zurück. Noch einmal will sie den Tatort sehen - und dann für immer vergessen. Zu spät erkennt sie, dass das nicht möglich ist. Denn die Einwohner von Stillwater misstrauen ihr zutiefst. Und ausgerechnet der einzige Mann, der an sie glaubt, bringt ihr dunkelstes Geheimnis in Gefahr
TOTGEGLAUBT
Kaltblütig hat er ihn umgebracht, die Leiche irgendwo auf seiner Farm verscharrt - die Einwohner von Stillwater sind überzeugt, dass an Clay Montgomerys Händen Blut klebt! Vor neunzehn Jahren verschwand Clays Stiefvater spurlos. Seitdem lebt der attraktive Farmer völlig zurückgezogen und scheut jeden Kontakt zu den Bewohnern des idyllischen Südstaatenstädtchens. Jetzt wird Allie McCormick, Spezialistin für ungelöste Fälle, auf Clay angesetzt. Frisch geschieden ist sie aus Chicago in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um die kalte Spur zu verfolgen. Und während sie bei Befragungen ihrem höchst sympathischen Verdächtigen näher kommt, wird auch die Spur allmählich heißer. Bis schließlich die grauenvolle Wahrheit zu Tage tritt …
TOTGESAGT
Die schöne Journalistin Madeline Barker hat es immer geahnt: Ihr Vater, der ehrenwerte Reverend Lee Barker, wurde vor zwanzig Jahren von einem Unbekannten verschleppt. Jetzt gibt es dafür endlich Beweise: In einem verlassenen Steinbruch wird sein Cadillac gefunden - darin deutliche Hinweise auf Gewalt und Missbrauch. Aber Madeline ist die einzige, die an einen unbekannten Täter glaubt. Denn beharrlich hält sich in Stillwater das Gerücht, ihre geliebten Stiefgeschwister hätten etwas mit dem Verschwinden des Gottesmannes zu tun. Entschlossen beauftragt Madeline den Privatdetektiv Hunter Solozano. Doch was der unkonventionelle Ermittler herausfindet, ist grausamer, als sie je für möglich gehalten hätte …