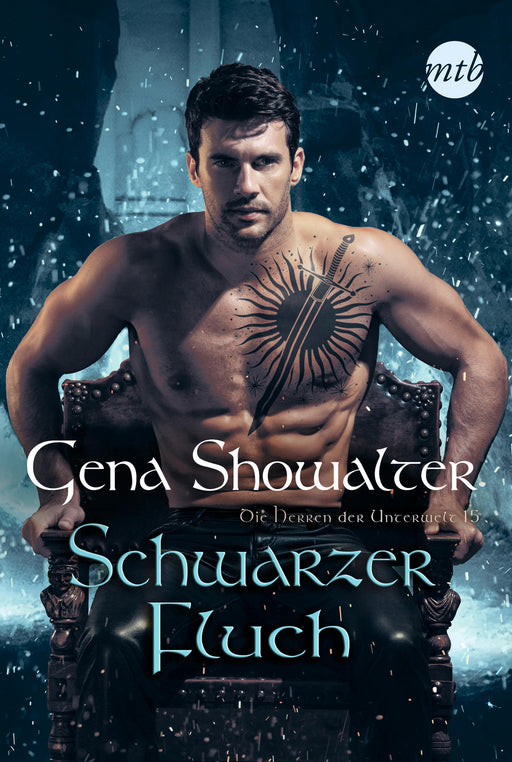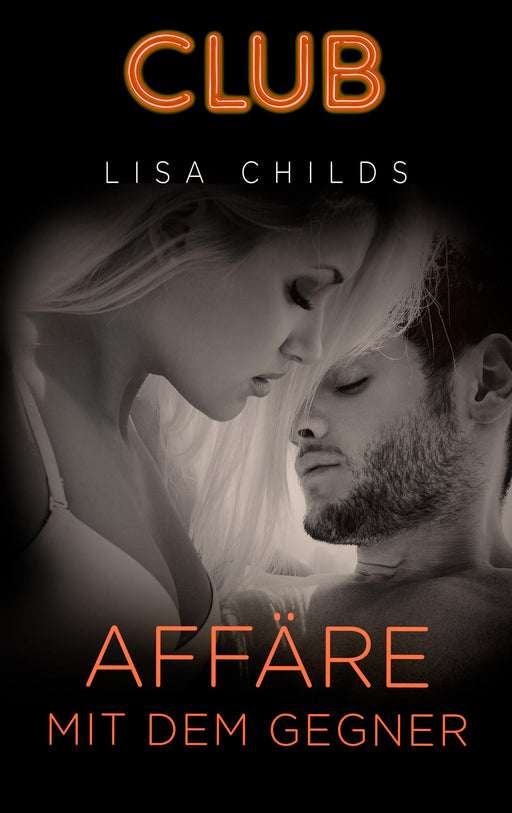Berühre meine Seele
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Kaylee ist eine Banshee, die mit ihrem Schrei den Tod besiegen kann. Aber auch den eigenen?
In der Highschool ist der Teufel los. Alle Mädchen stehen auf den neuen Mathelehrer Mr Beck. Alle außer Kaylee. Denn sie erkennt, was hinter der starken Anziehungskraft des Lehrers steckt: Beck ist ein Inkubus, der sich von der Lust und Leidenschaft ihrer Mitschülerinnen nährt. Kaylee muss ihre ahnungslosen Freundinnen retten - bevor Beck hinter ihr Geheimnis kommt. Doch da entdeckt Todd ihren Namen auf der Todesliste der Reaper... Selbst wenn es Kaylee gelingt, Beck loszuwerden, gibt es scheinbar nichts, was ihren Tod verhindern kann.