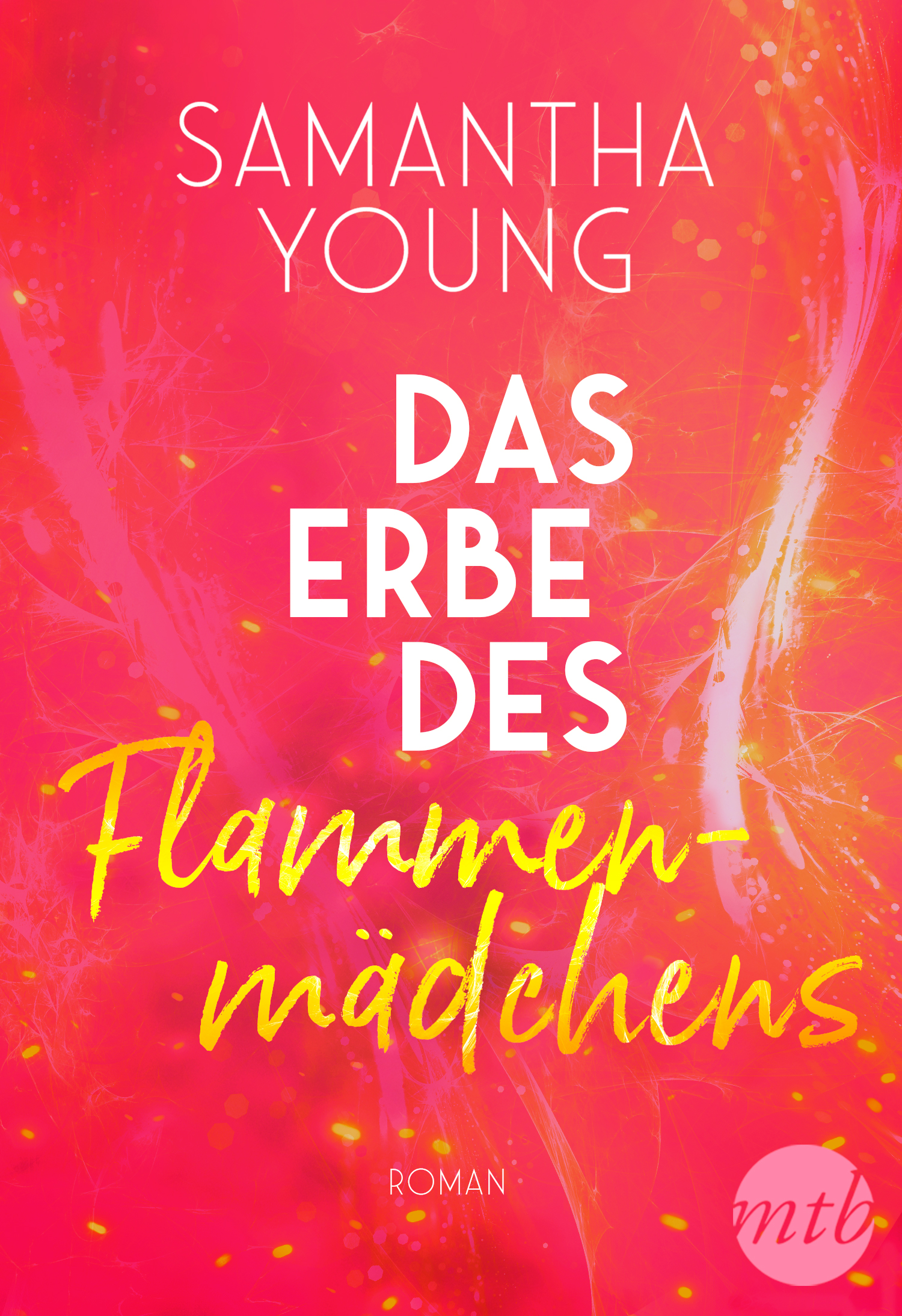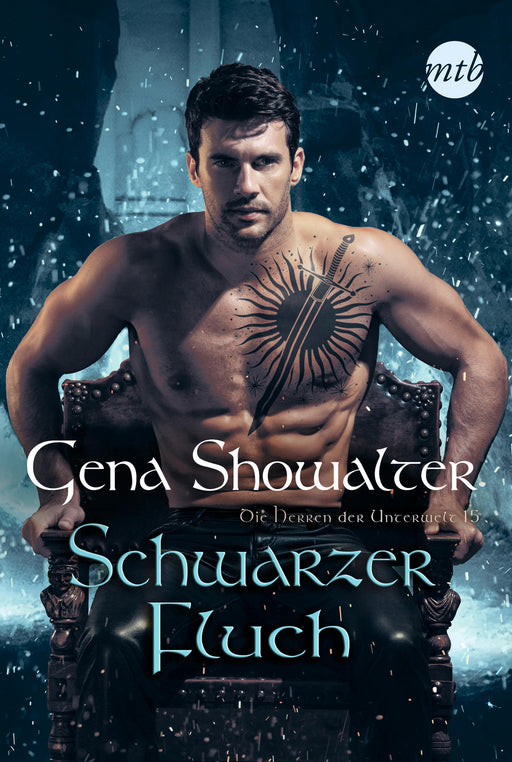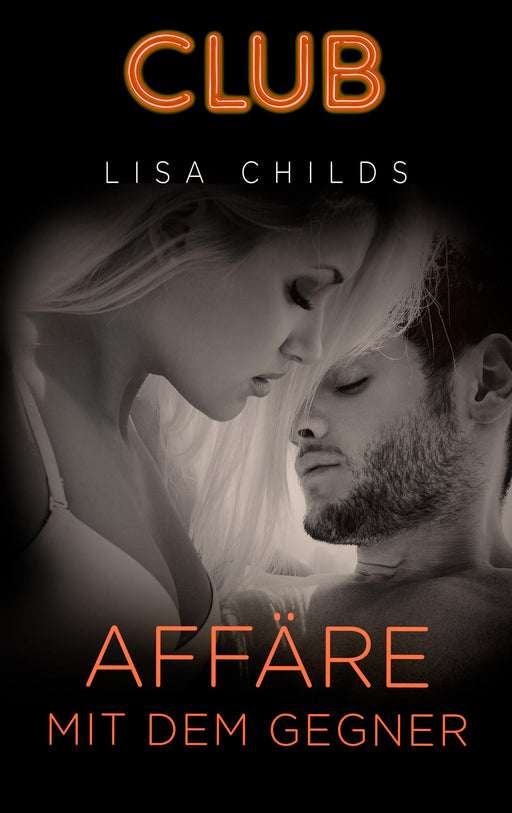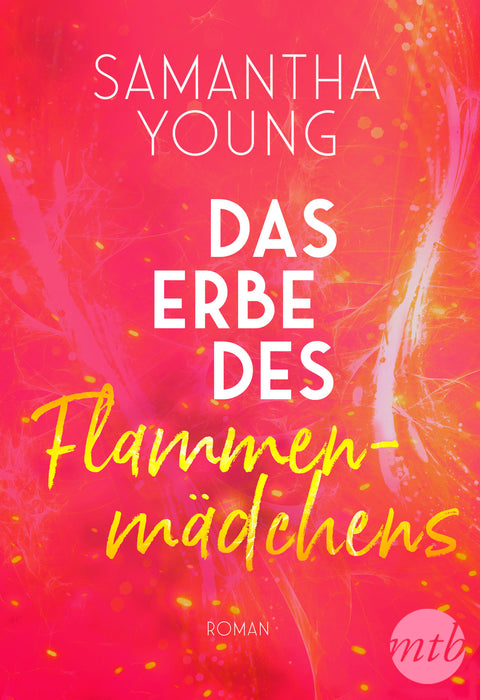
Das Erbe des Flammenmädchens
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Als "Siegel Salomons" hat Ari zwar - theoretisch - unbegrenzte Macht über alle Dschinns, doch ihr eigenes Leben gerät völlig außer Kontrolle. Ein skrupelloser Zauberer will sie entführen, und der White King der Feuergeister droht damit, ihr alles zu nehmen, was sie liebt. Die Einzigen, auf die sie zählen kann, sind Jai und Charlie. Aber auch Aris Beziehungen zu den beiden Jungs wird immer komplizierter: Jai scheint ihre Gefühle nicht zu erwidern. Und ihre Jugendliebe Charlie erliegt langsam den Versuchungen der dunklen Seite. Kann Ari ihn vor sich selbst retten - oder ist es bereits zu spät?