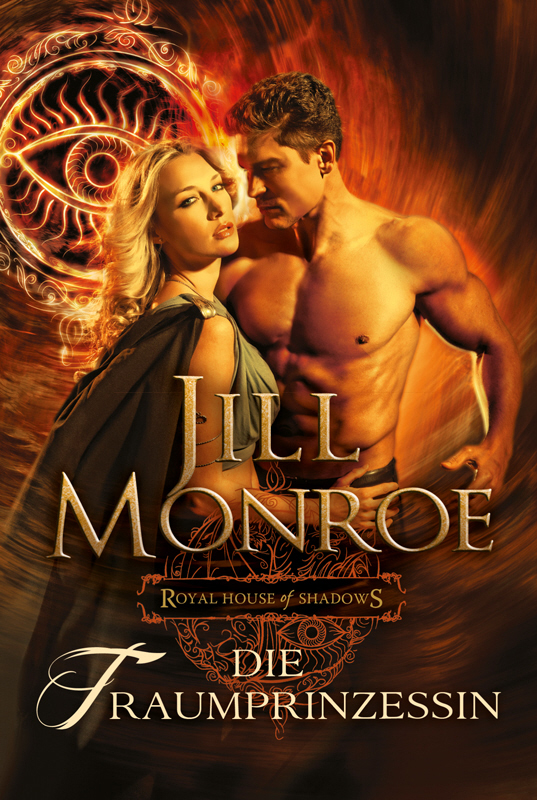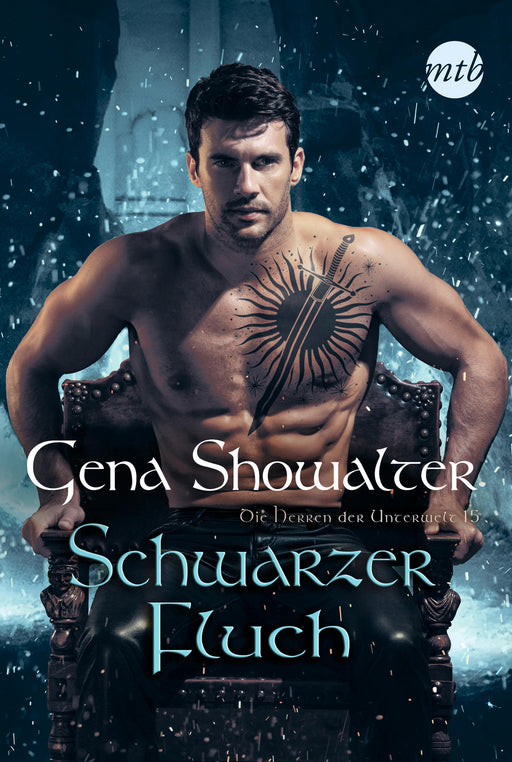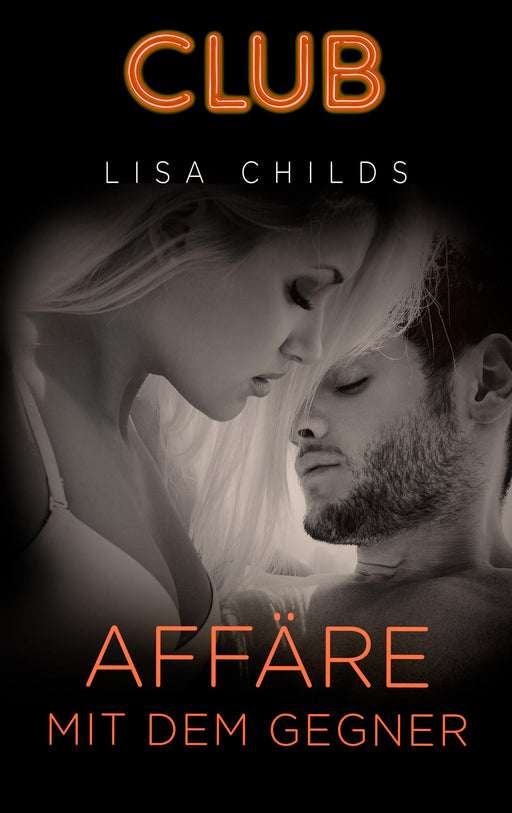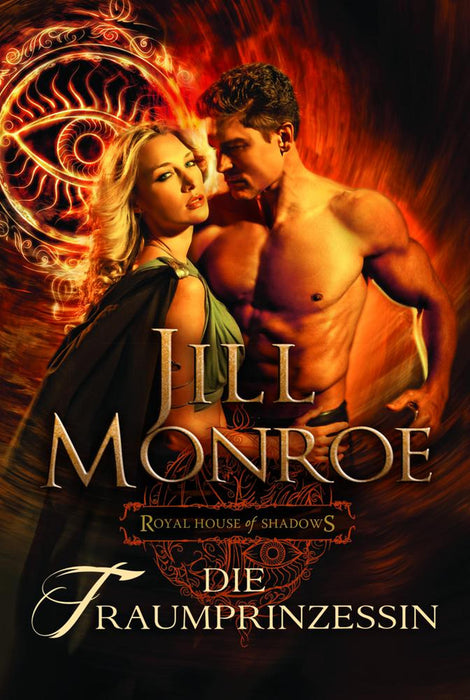
Die Traumprinzessin
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Seite an Seite lebten Gestaltwandler, Werwölfe und Vampire im magischen Elden. Bis der grausame Blutzauberer das Königspaar stürzte. Erst wenn sich die vier Erben verbünden, kann Elden wieder aufblühen. Die Stunde der Entscheidung naht …
In jener Nacht, als Prinzessin Breena aus dem Schloss ihrer Kindheit floh, träumte sie von ihm: von einem Kämpfer, unbezwingbar wie ein mächtiger Bär, gefährlich und wild. Jetzt, fern von Elden und in tiefster Wildnis, kreuzen sich ihre Wege, als Breena in seiner Hütte Unterschlupf sucht. Atemlos steht sie dem Gestaltwandler gegenüber, der sich genauso an den gemeinsamen Traum erinnert. Osborn soll sie lieben - und ihr mit seinen übermenschlichen Kräften zur Seite stehen, wenn sie den Blutmagier herausfordert …