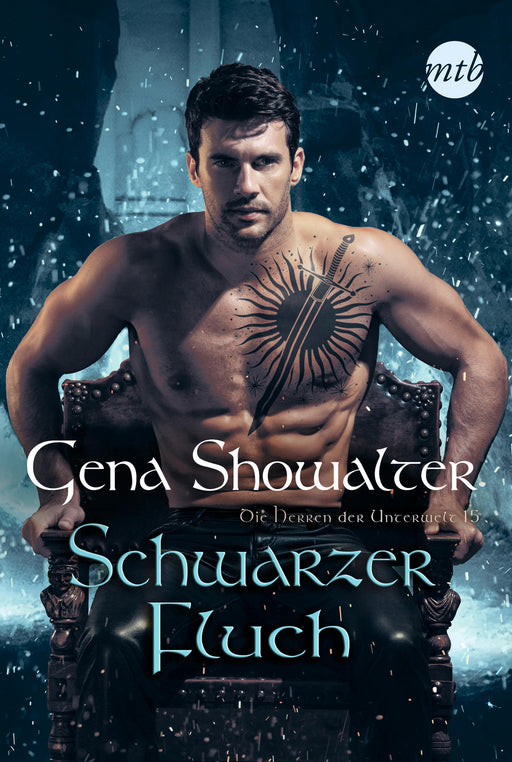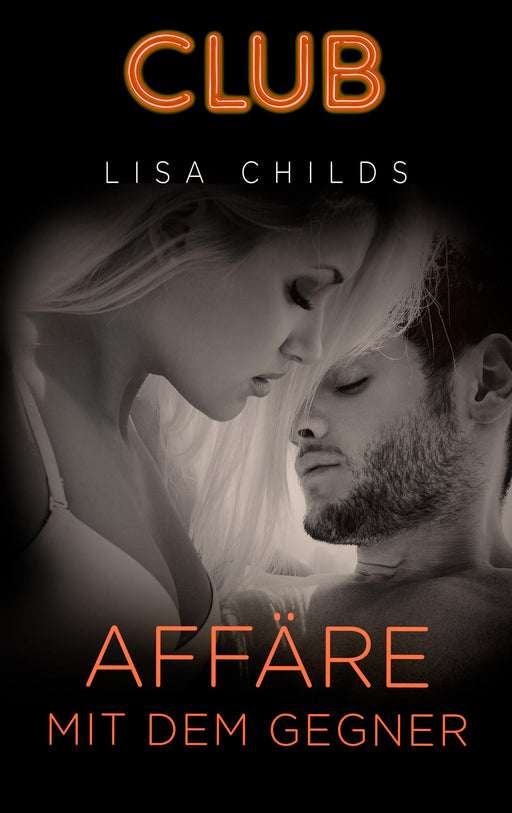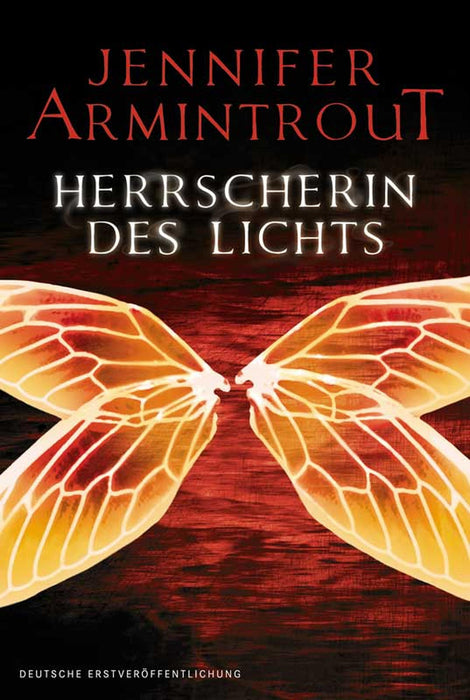
Herrscherin des Lichts
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Die Welten unter uns: Atemberaubender Auftakt der neuen Fantasy-Trilogie von Bestsellerautorin Jennifer Armintrout!
Sie waren unter uns: Magische Geschöpfe sind in die Welt der Menschen gekommen, doch sie wurden zurückgedrängt. Tief unter den Städten leben nun elfische Kreaturen, aber auch Vampire und Todesengel im beständigen Kampf gegeneinander. Licht oder Schatten? Die Entscheidung wird kommen …
Eine Elfe? Leichte Beute für den Todesengel Malachi, der auf Seelenjagd die Unterwelt durchstreift. Doch die bloße Berührung der Halbelfe Ayla wird ihm zum Verhängnis: Ihr menschliches Blut kostet ihn seine Unsterblichkeit. Er, früher göttergleich, ist jetzt ausgestoßen und verdammt dazu, wie ein Mensch zu empfinden! Dafür soll Ayla bezahlen … Aber als Malachi ihr erneut begegnet, rettet sie ihm das Leben. Ein Pakt zwischen Hass und Liebe wird geschlossen - und auf den dunklen Schwingen ihres Verlangens erfüllt sich eine uralte Prophezeiung.