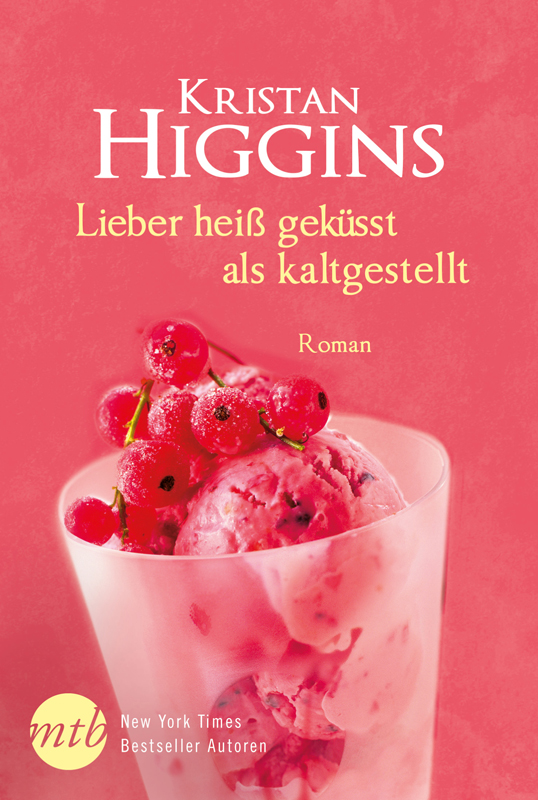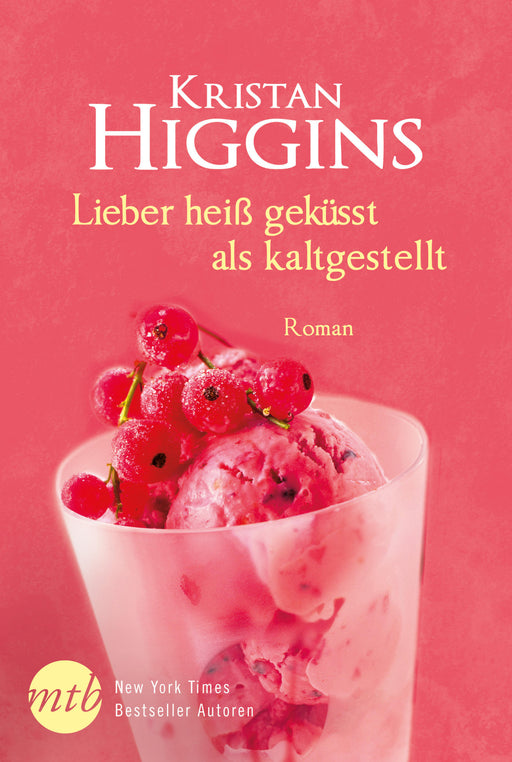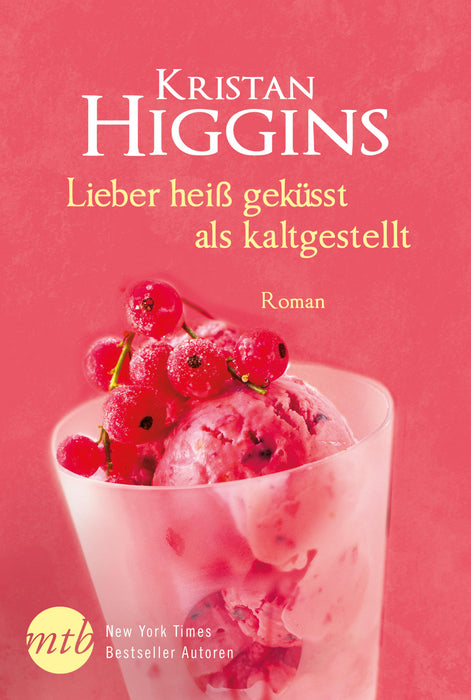
Lieber heiß geküsst als kaltgestellt
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Jessica sieht keinen Grund, ihre lockere Beziehung zu Connor auf die nächste Stufe zu heben. Schließlich hat ein Freund mit Vorzügen noch niemandem geschadet. Davon abgesehen hat sie neben ihrem Kellnerjob und ihrem Bruder, um den sie sich kümmert, ohnehin keine Zeit für eine Ehe. Alles könnte also weitergehen wie bisher - wäre da nur nicht diese Eifersucht, als Connor beschließt, sich eine andere Braut zu suchen …
"Ein atemberaubender, herzzerreißender und unwiderstehlicher Liebesroman." Kirkus Reviews