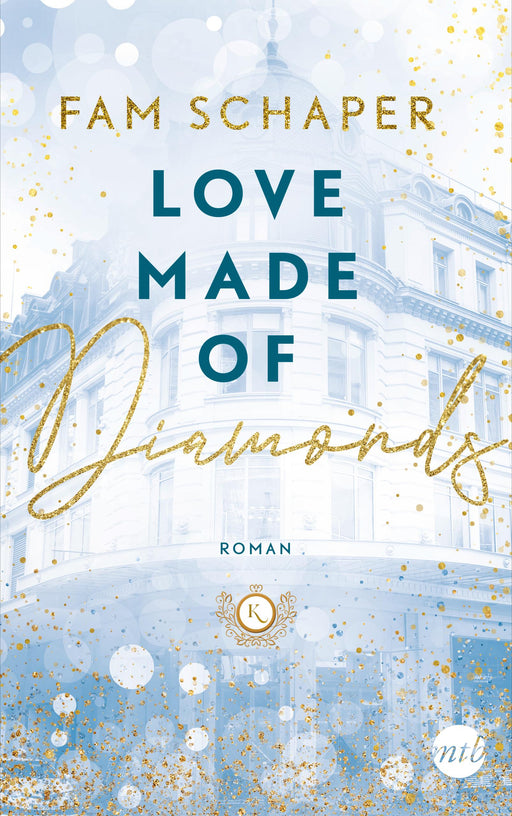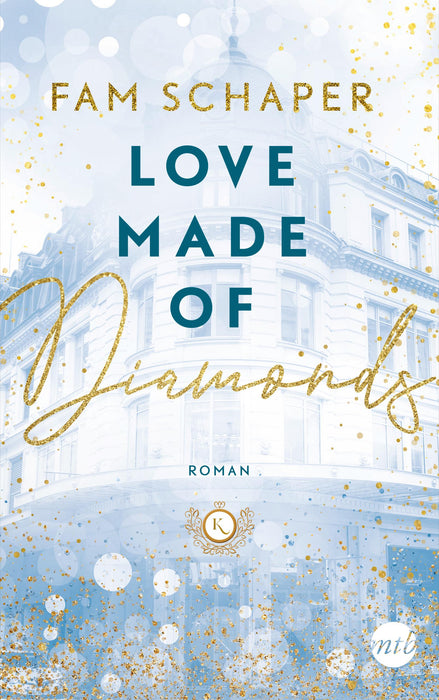
Love Made of Diamonds
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Luxus, Skandale und die ganz großen Gefühle
Als ihr Bruder August starb, hat Stella fluchtartig ihre Heimat verlassen. Zwei Jahre später muss sie wegen eines Familiennotfalls nach München zurückkehren – und sich den Menschen stellen, die sie damals zurückgelassen hat. Auch ihrem Ex-Freund Matthew, der jetzt ausgerechnet im Kaufhaus ihrer Familie arbeitet. Eigentlich will sie so schnell wie möglich wieder verschwinden, doch dann stößt sie auf Hinweise, dass Augusts Flugzeugabsturz kein Unfall war. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit gerät sie ständig mit Matthew aneinander. Ihr Herz schlägt noch immer für ihn, aber reichen die Wunden der Vergangenheit zu tief, um jemals zu heilen?