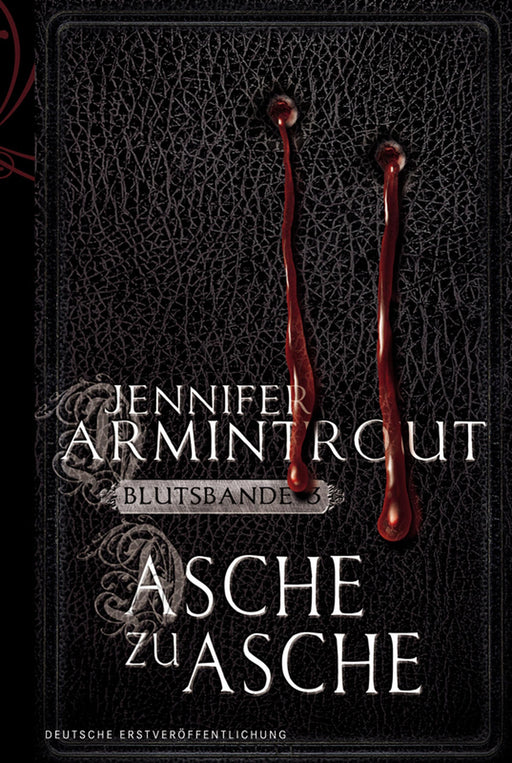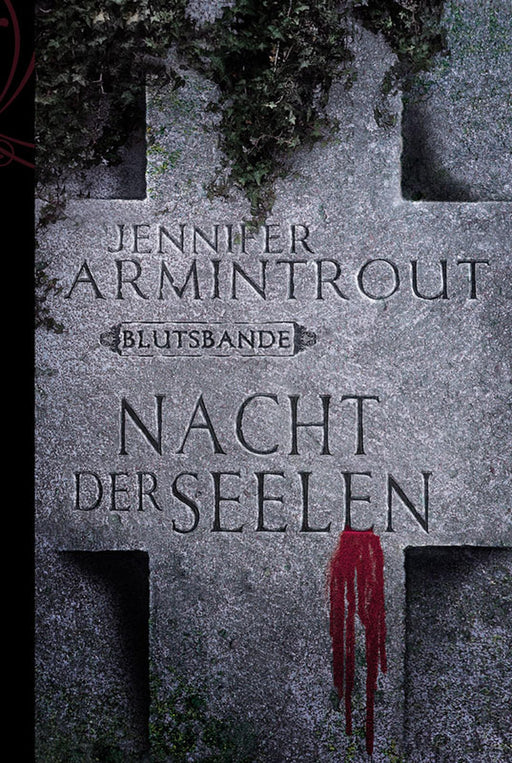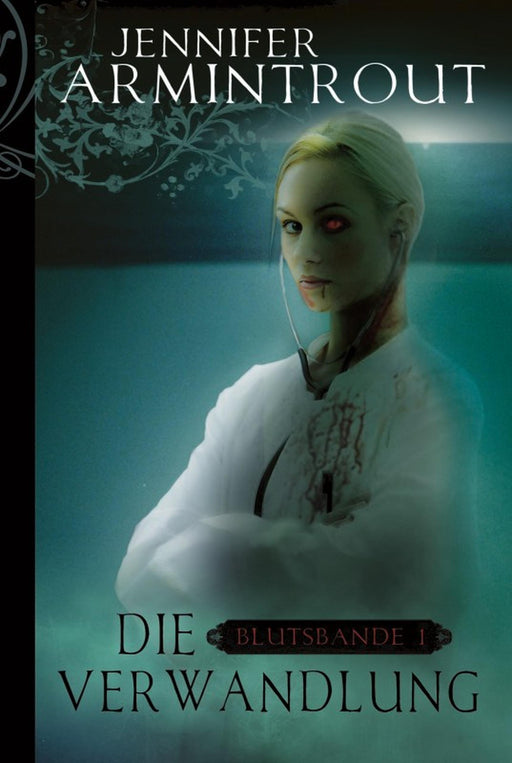Nacht der Seelen
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
4. und letzter Band von Jennifer Armintrouts erfolgreicher Blutsbande-Serie: Gelingt es der Vampirin Carrie, die Welt vor dem Bösen zu retten und den Soul Eater zu vernichten?
Kaum ist die Liebe zwischen der Vampirin Carrie und Nathan neu entflammt, schlägt das Böse wieder zu: Nathan wird von den Gefolgsleuten des Soul Eaters entführt und grausam gefoltert. Voller Verzweiflung schwört Carrie Rache. Und diesmal ist sie bereit, alles zu geben, um ihren Erzfeind zu vernichten - sogar ihr Leben. Nichts kann sie mehr stoppen, als es in einer dramatischen Nacht zu einem letzten Kampf mit dem Herrscher der Finsternis kommt …