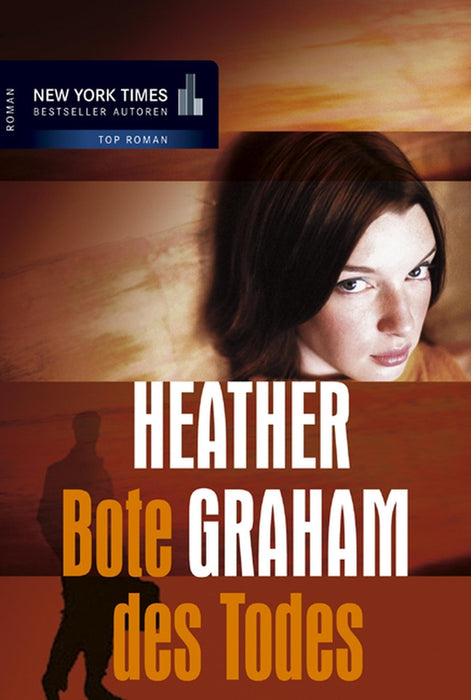
Bote des Todes
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Die engagierte TV-Produzentin Moira will die tödlichen Machenschaften der IRA aufdecken, um das Leben des irischen Politikers Jacob Brolin zu retten. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Kollegen Michael. Er spielt ihr Informationen zu, die den irischen Journalisten Dan O'Hara, ihren früheren Geliebten, als Drahtzieher des Mordkomplotts aufzeigen. Doch dann macht Moira eine schreckliche Entdeckung...












