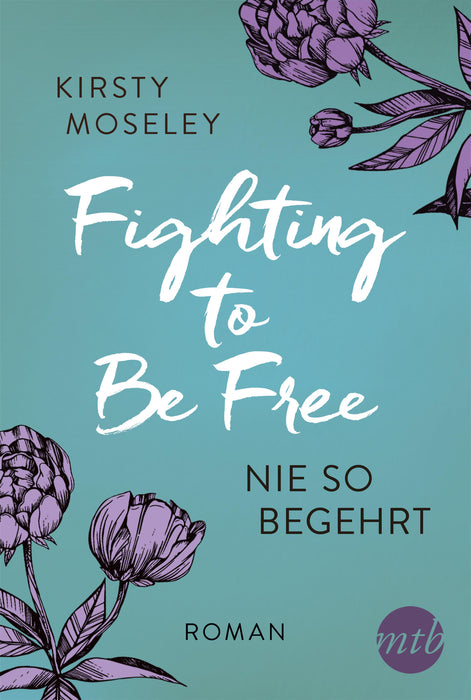
Fighting to Be Free - Nie so begehrt
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Seit Jamie Cole die Liebe seines Lebens von sich gestoßen hat, ist er ein anderer Mann geworden. Ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft verstrickt er sich tiefer in die Machenschaften der New Yorker Unterwelt. Doch plötzlich ist Ellie zurück. Obwohl es Jamie zu zerreißen droht, versucht er sich von ihr fernzuhalten, um sie zu schützen. Jamie würde alles für sie tun. Aber seine Feinde haben nur darauf gewartet, dass er endlich eine Schwachstelle offenbart.
"Wer Bad Boys liebt, muss Fighting to be free - Nie so begehrt einfach lesen (…) Fantastisch!"
Romantic Times Book Reviews
"Packend, herzzerreißend und ein umwerfender Held, der einen dahinschmelzen lässt."
Sophie Jackson, Bestsellerautorin über "Fighting to be free - Nie so geliebt"











