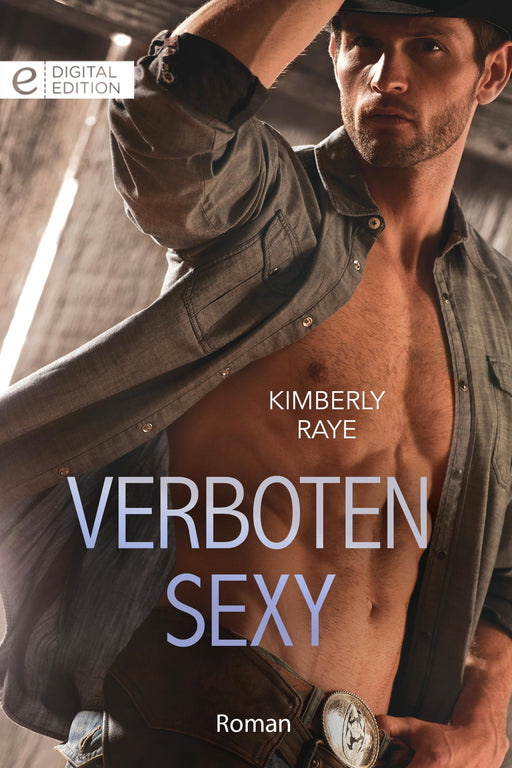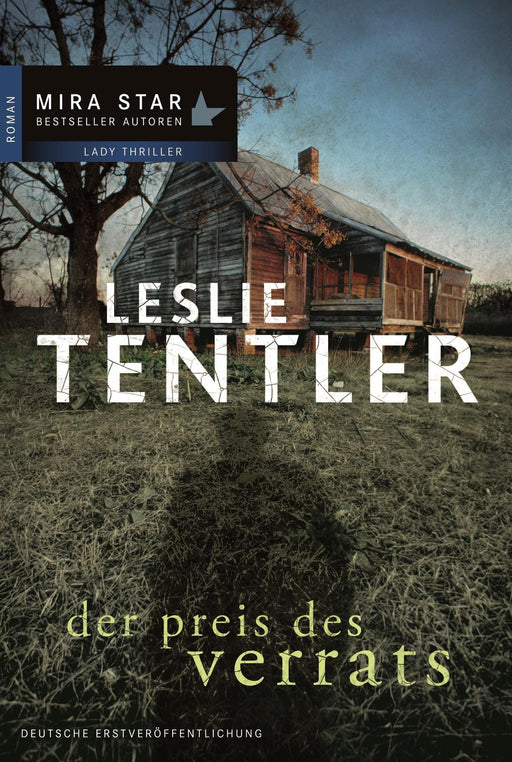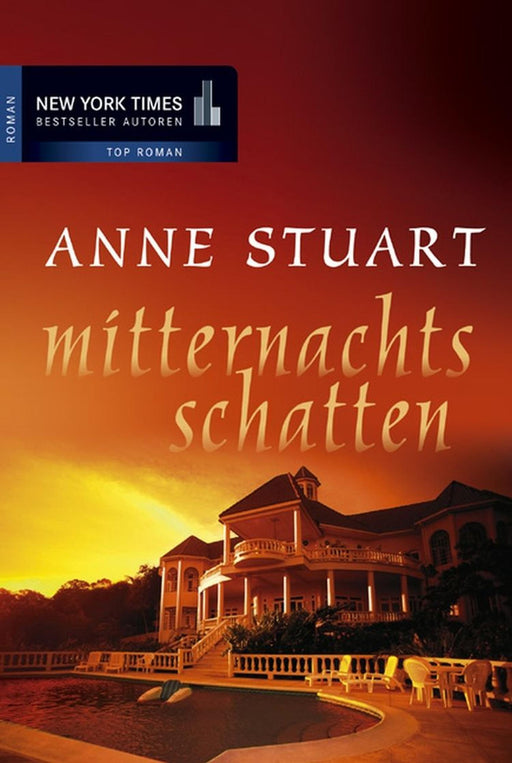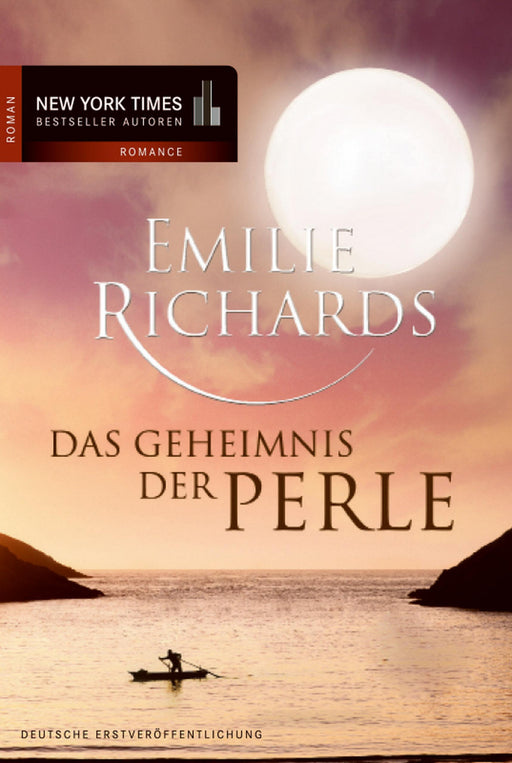Heißkalte Angst
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Vier spannende Thriller der internationalen Bestsellerautorin Tess Gerritsen!
Der Anruf kam nach Mitternacht
Auf der Suche nach dem Mörder ihres Mannes hat Sarah nur einen Verbündeten: den verführerischen Nick O`Hara. Noch bevor sie verstehen, was passiert, sind sie jedoch Gejagte in einem riskanten Spiel, in dem Informationen alles und Menschenleben nichts bedeuten.
Angst in deinen Augen
Zweimal rettet der Cop Sam der Krankenschwester Nina das Leben. Er sieht die Angst in ihren Augen und verliebt sich in Nina. Aber solange er nicht weiß, wo ihr grausamer Feind lauert, darf er sich nicht zu seinen Gefühlen bekennen!
Sag niemals stirb
Wilone will in Vietnam die Wahrheit über das Schicksal ihres spurlos verschwundenen Vaters herausfinden. Begleitet von dem attraktiven Biologen Guy, begibt sie sich auf eine lebensgefährliche Suche - denn ein unberechenbarer Widersacher ist ihnen stets einen Schritt voraus.
Gefährliche Begierde
Hat Miranda wirklich seinen Halbbruder Richard umgebracht? Anfangs ist Chase fest davon überzeugt, bald wachsen seine Zweifel. Wenn die Frau, deren Ausstrahlung ihn so fesselt, es aber nicht war … Wer hat Richard dann auf dem Gewissen?