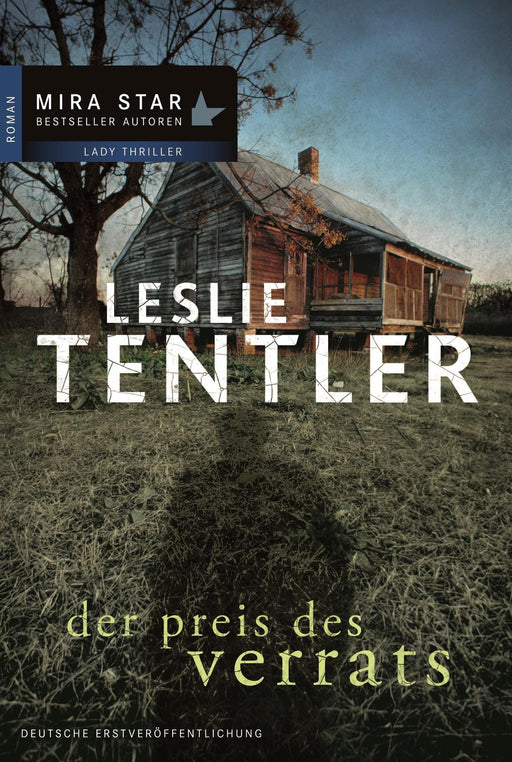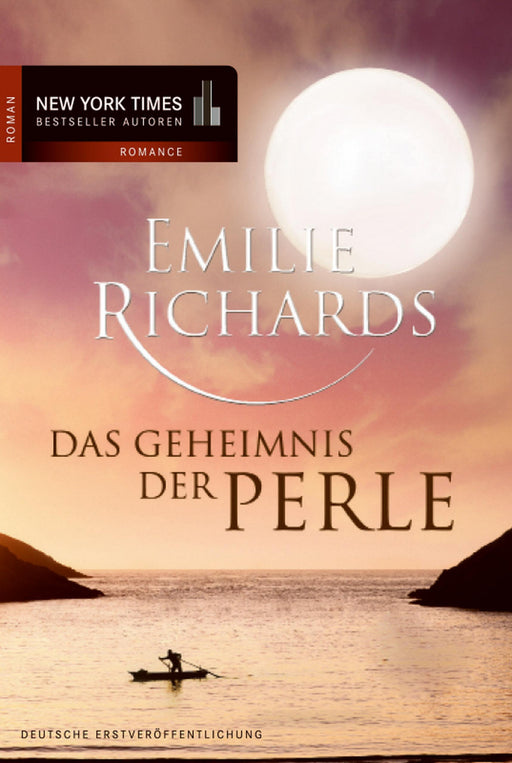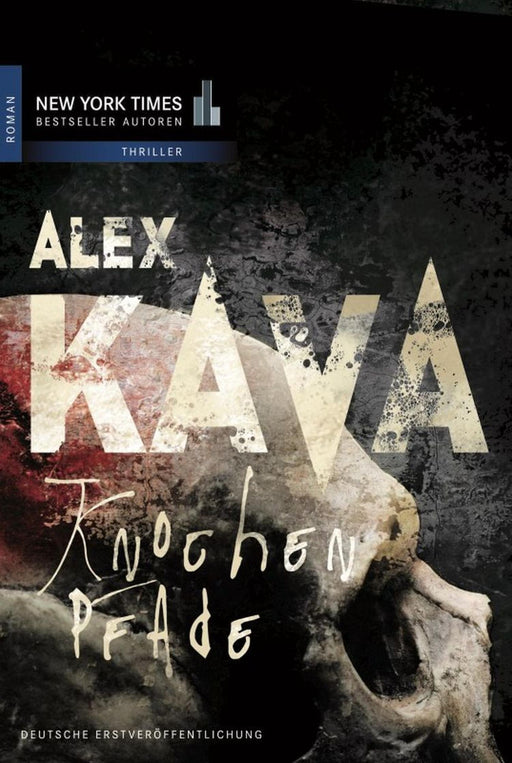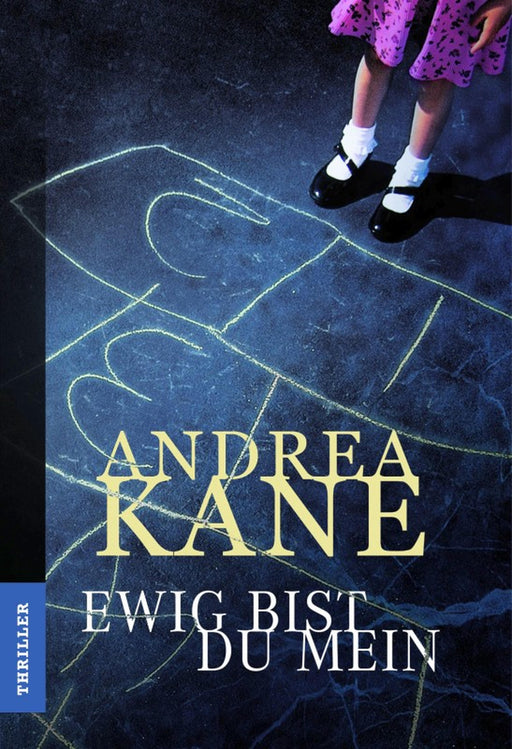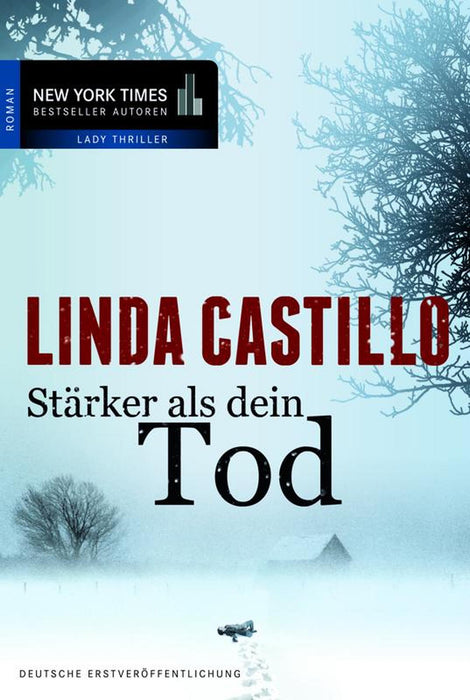
Stärker als dein Tod
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Emily Monroe ist wie gelähmt vor Angst! Zu spät für die Security-Frau, per Funk einen Ausbruch aus dem Hochsicherheitstrakt zu melden: Der Flüchtige überwältigt sie und nimmt sie als Geisel. Ihr
persönlicher Albtraum ist wahr geworden.
Doch Zack Devlin ist kein Schwerverbrecher, sondern CIA-Agent in gefährlicher Mission. Undercover ermittelt er, warum immer wieder lebenslang Verurteilte spurlos verschwinden. Zack vermutet ein mörderisches Komplott. Aber dafür braucht er Beweise - und bestimmt nicht eine Frau wie Emily, in deren Nähe aus Adrenalin plötzlich pure Leidenschaft wird.