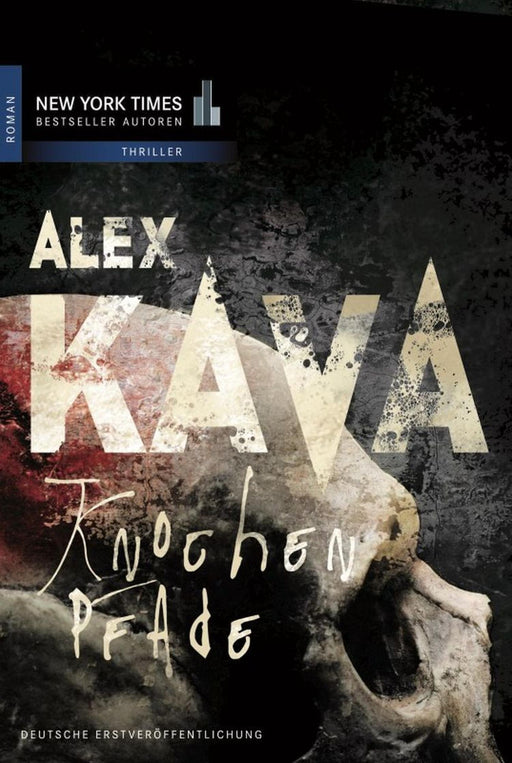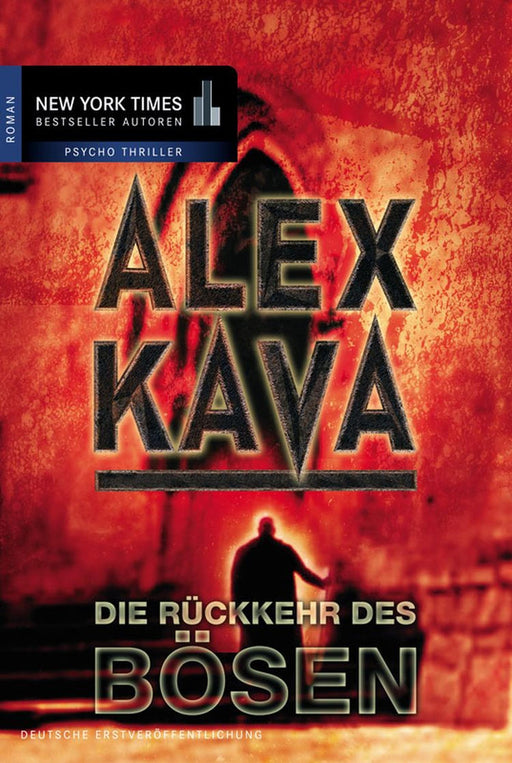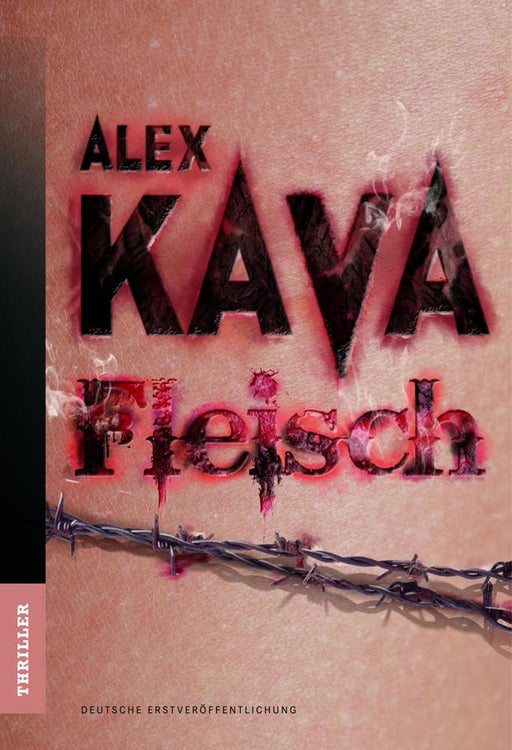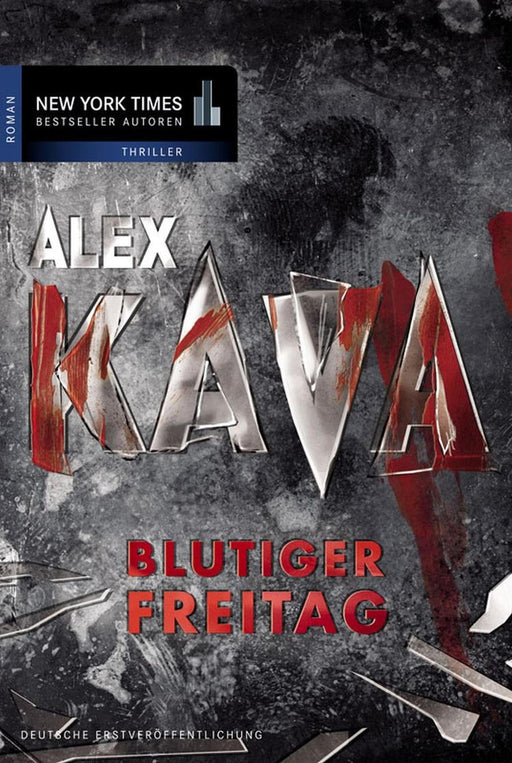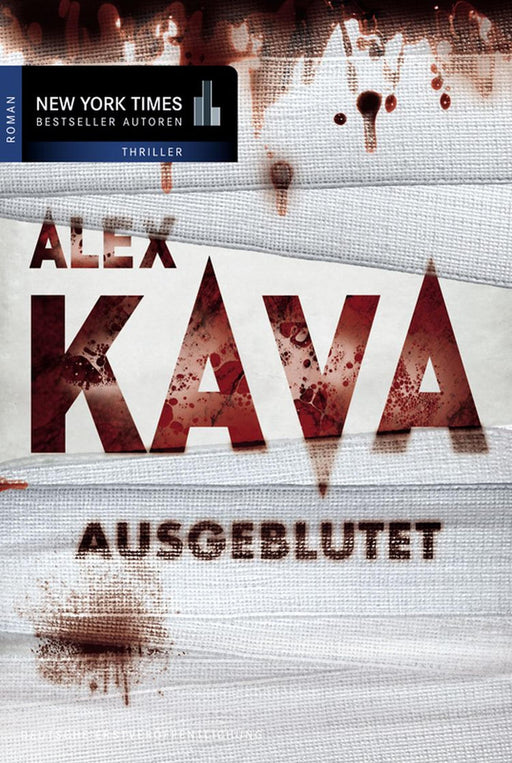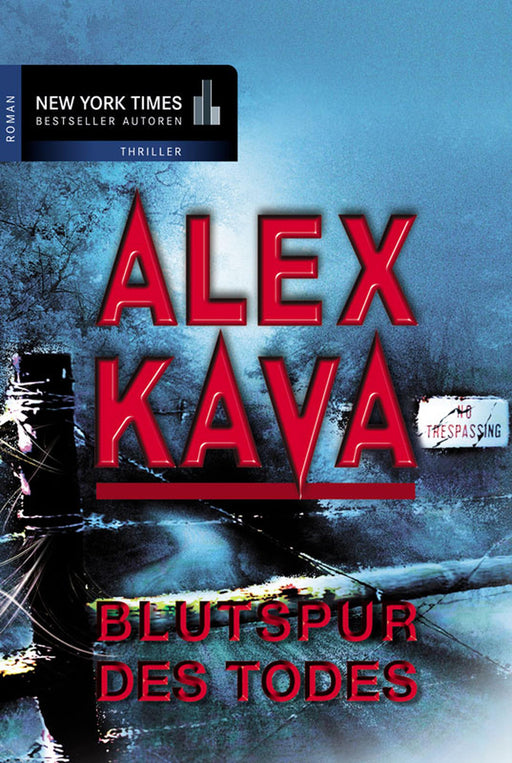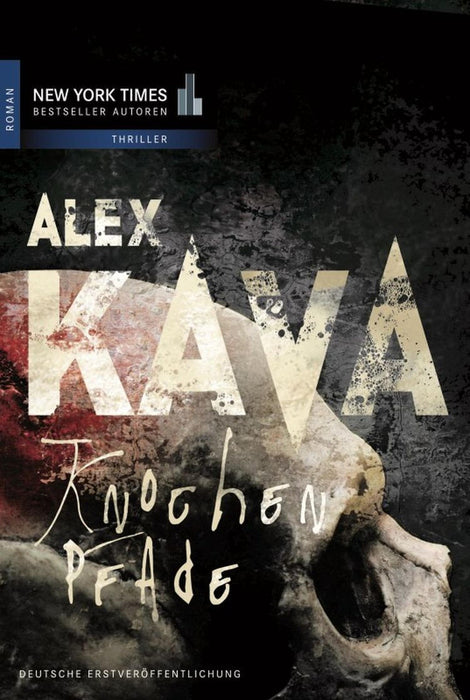
Knochenpfade
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Eine Kühlbox voller Leichenteile, abgepackt und nummeriert. Schockiert betrachtet Maggie O'Dell, was die Küstenwache aus dem Meer gefischt hat. Woher stammen die grausigen Funde? Und warum diese merkwürdige Verpackung? Handelt es sich um das Souvenir eine perversen Massenmörders? Oder ist die Wahrheit noch viel schlimmer? Während ein Hurrikan auf Florida zurast, ermittelt die erfahrene FBI-Profilerin - und gerät mitten ins Auge des Orkans. Denn sie kommt einer schrecklichen Wahrheit auf die Spur: Immer wieder sind in letzter Zeit Menschen spurlos verschwunden. Und plötzlich nimmt auch Maggies eigenes Leben eine dramatische Wende: Der blutige Pfad führt sie zu ihrem Freund Dr. Benjamin Platt.