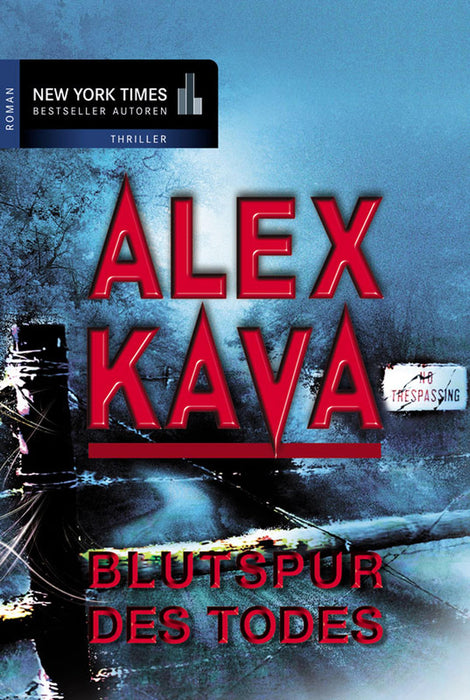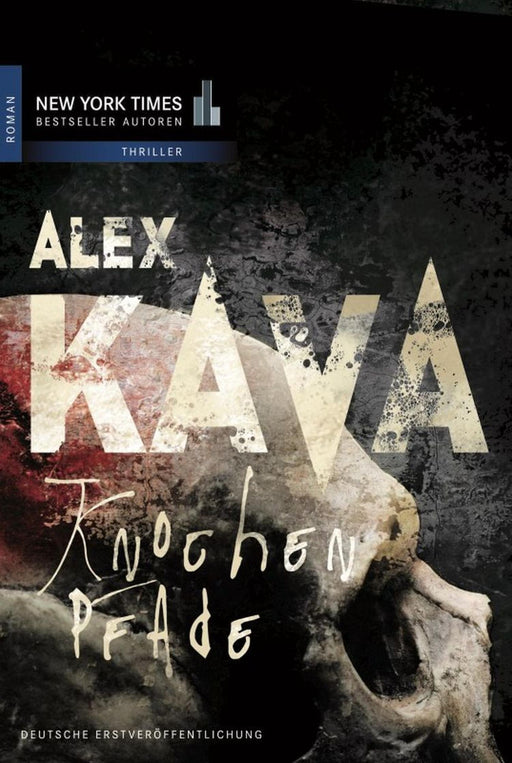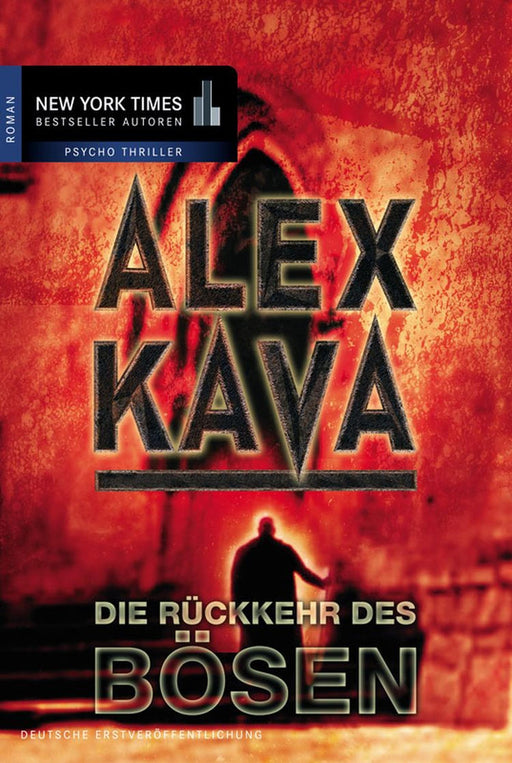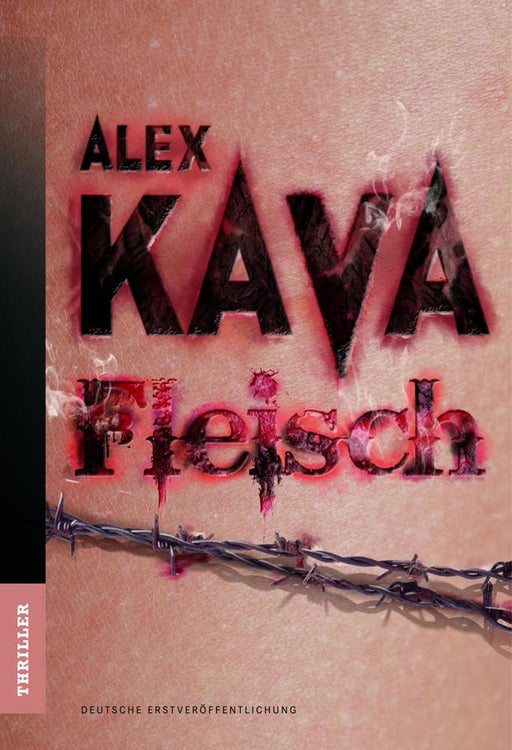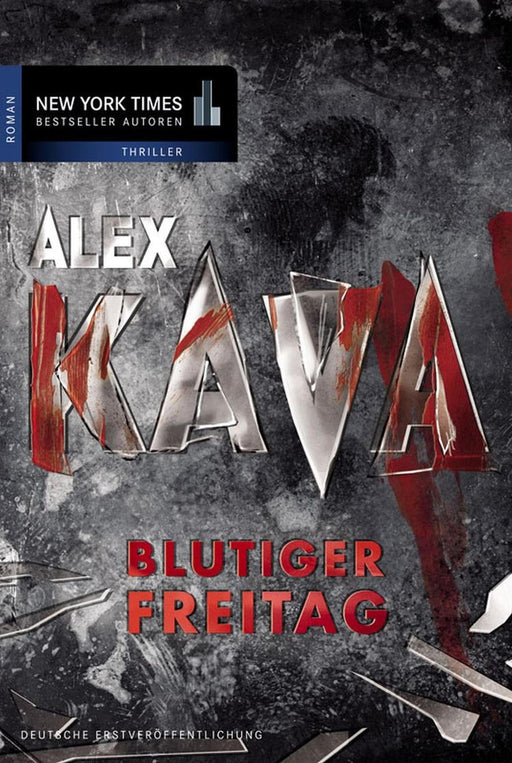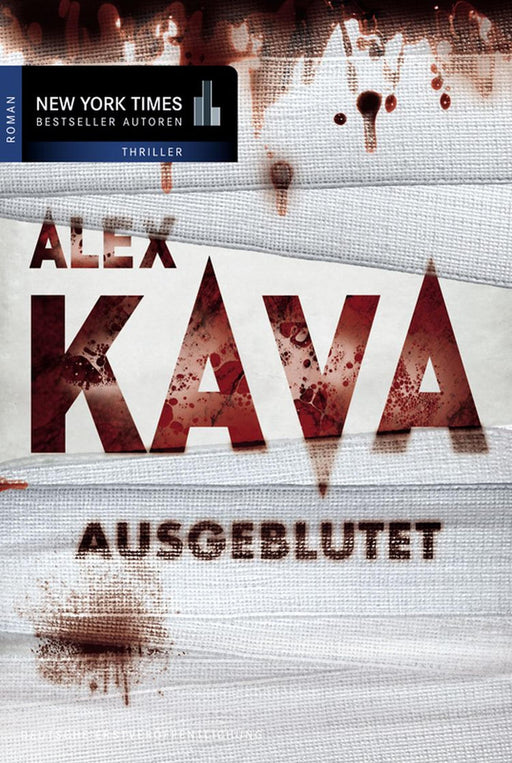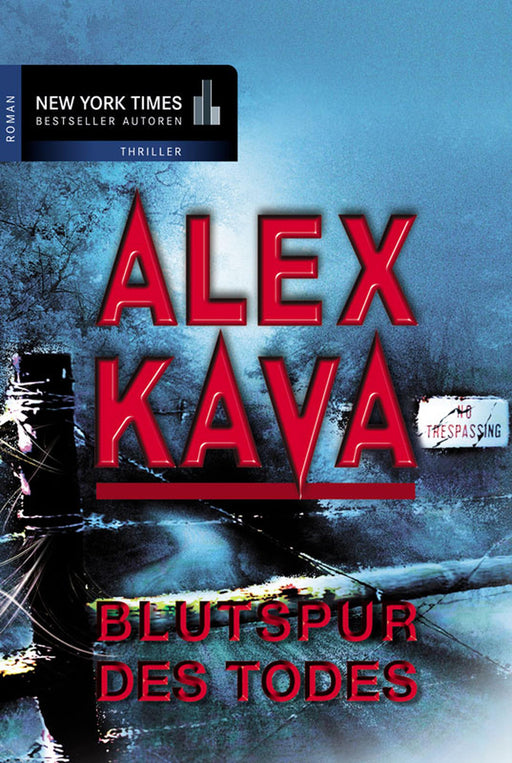Erster Teil
AUS MANGEL AN BEWEISEN
Freitag, 27. August
Prolog
13.13 Uhr
Lincoln, Nebraska: Staatsgefängnis
Max Kramer trug einen blauen Anzug und dazu seine rote Glückskrawatte. Während der Wachmann ihm die Tür aufschloss, musterte er sein Spiegelbild in der Scheibe aus Sicherheitsglas. Die neue Tönung wirkte wirklich Wunder, er konnte kaum noch ein graues Haar entdecken. Seine Frau behauptete zwar, das grau Melierte stünde ihm hervorragend, aber solche Dinge sagte sie immer, wenn sie ahnte, dass er wieder mal auf der Jagd nach einer Neuen war. Großer Gott, sie kannte ihn wirklich gut, weit besser, als ihr selbst bewusst war.
„Ihr großer Tag“, sagte der Hüne von einem Wachmann, doch sein finsteres Gesicht wich keinem Lächeln.
Max waren die Schimpfworte zu Ohren gekommen, mit denen die Wachen ihn in den letzten Wochen bedacht hatten, und er wusste, dass er nicht gerade ein gern gesehener Besucher hier im Todestrakt war. Aber das galt nur auf die Beamten. Für die Insassen war er geradezu ein Held, und sie waren es, die zählten, nur auf sie kam es an. Sie brauchten ihn, um das ihnen widerfahrene Unrecht anzuklagen, um ihre Geschichte loszuwerden. Ihre Version der Geschichte, besser gesagt. Nur um sie ging es ihm. Allerdings keineswegs, weil er etwa ein liberales Weichei gewesen wäre, wie ihn der Omaha World Herald und der Lincoln Journal Star wiederholt genannt hatten.
Seine Motivation war weit weniger ehrenhaft. Die harte Arbeit, sein ganzer Einsatz, all das diente allein dazu, einen Tag wie diesen auszukosten. Zu erleben, wie sein Klient dieses Höllenloch aus Beton verließ. Es zählte nur dieser Moment, in dem er mit einem Todeskandidaten durch das Haupttor in den Sonnenschein und in die Freiheit schritt – in das Blitzlichtgewitter der Fotografen und vor die Kameras der Fernsehsender aus dem ganzen Land. Morgen saß er mit Jared bei Larry King auf CNN. Und heute Abend würde er seine rote Krawatte auf NBC bei Brian Williams präsentieren.
Ja, das waren die Auftritte, auf die er sein ganzes Leben hingearbeitet hatte. Sie machten die lausigen Honorare und die ewigen Überstunden wett. Und auch die Angriffe der Lokalpresse würden jetzt verstummen.
Er blieb vor dem Besucherraum stehen, als wolle er die Privatsphäre seines Klienten respektieren. Alles Theater. In Wahrheit wollte er mit diesem Jared Barnett nicht eine Sekunde länger als nötig verbringen. Er musterte ihn von der Türschwelle aus. Barnett trug dieselbe verwaschene Jeans und dasselbe rote T-Shirt wie am Tag seiner Einlieferung. Beides hatte er abgeben müssen, als er vor fünf Jahren hier eingewiesen wurde. Allerdings traten unter dem T-Shirt nun deutlich die Muskeln hervor, die er sich während seiner Haft antrainiert hatte. Erst jetzt, wo Barnett nicht mehr den orangefarbenen Sträflingsoverall anhatte, fiel Max auf, wie ordinär der Mann aussah. Sein kurzes dunkles Haar war ungekämmt, als sei er gerade aus dem Bett gekrochen, und sollte wohl cool wirken. Wahrscheinlich würde die Frisur nach Barnetts Fernsehauftritten der neue Renner werden.
Max hatte sich die größte Mühe gegeben, seinen Klienten zu dem ewig missverstandenen Verlierer zu stilisieren, der auf die schiefe Bahn geraten und dann von der Justiz hereingelegt worden war, was ihn fünf Jahre seines ohnehin schon traurigen Lebens gekostet hatte. Barnett musste seine Rolle jetzt nur weiterspielen, das passende Aussehen hatte er jedenfalls.
Der Wachmann trat beiseite und gab die Tür frei.
„Jetzt kommt der Papierkram“, erklärte er. „Wenn Sie wollen, können Sie drinnen warten.“
Max nickte, als sei er dankbar für die Einladung, die der Wachmann offenbar für ein Entgegenkommen hielt. Dabei wäre es ihm sehr viel lieber gewesen, wenn der Mann ihn unten in der Halle hätte warten lassen. Aber nun war es zu spät. Jared hatte ihn bereits erkannt und winkte ihn herein. Als Max eintrat, stand er auf. Ein unschuldig Veruteilter mit besten Manieren, gut machte er das.
„Setzen Sie sich“, sagte Max. Er griff nach einem der Klappstühle und schob ihn in Barnetts Richtung. Das kratzende Geräusch des Metalls auf dem Fußboden ließ ihn zusammenzucken. Er merkte, dass er nervös war. Barnett würde ihm hoffentlich keinen Strich durch die Rechnung machen, sobald er wieder gehen konnte, wohin er wollte.
„Mann, ich hätte nicht geglaubt, dass Sie das tatsächlieh durchziehen“, sagte Barnett. Er setzte sich wieder und hatte offenbar kein Problem damit, dass Max stehen blieb. Max hatte sich das vor langer Zeit angewöhnt, schon in seinen ersten Jahren als Strafverteidiger. Lass sich den anderen setzen und bleib selbst stehen, das verschafft dir Autorität. Da Max gerade einen Meter sechzig maß, machte er von diesem Trick regelmäßig Gebrauch.
„Also, wie läuft das jetzt?“ fragte Barnett, obwohl Max es ihm schon während des Wiederaufnahmeverfahrens mehrfach erklärt hatte. Sein Klient schien immer noch zu glauben, die Sache habe einen Haken. „Bin ich wirklich frei und kann gehen?“
„Ohne die Aussage von Danny Ramerez ist der Fall für die Anklage zusammengebrochen, sie konnte sich nur noch auf Indizien stützen. Ohne einen Augenzeugen kann keinerlei Verbindung zwischen Ihnen und Rebecca Moore nachgewiesen werden.“ Max fixierte Barnett, konnte jedoch keinerlei Reaktion erkennen. „Dass Mr. Ramerez es sich anders überlegt und zugegeben hat, in jener Nacht nicht einmal vor der Tür gewesen zu sein, hat Ihnen den Kopf gerettet.“
Barnett sah ihn an und grinste, und in seinem Gesicht lag etwas, das Max schaudern ließ. Während des gesamten Verfahrens hatte er es nicht gewagt, Barnett zu fragen, wie er Ramerez dazu bringen konnte, seine ursprüngliche Aussage zu widerrufen. Aber er war sich sicher, dass er aus dem Gefängnis irgendwie nachgeholfen hatte.
„Was ist mit den anderen?“ fragte Barnett.
„Wie bitte?“
Max wartete auf eine Erklärung, doch Barnett saß nur da und säuberte sich mit den Zähnen die Fingernägel. Das hatte er häufig auch im Gericht getan, wahrscheinlich eine nervöse Angewohnheit. Max fragte sich, ob er richtig gehört hatte. Großer Gott, welche anderen denn?
Er hatte Barnetts Fall erst im Wiederaufnahmeverfahren übernommen, aber er wusste natürlich, dass es noch andere Frauen gab, die auf genau die gleiche Weise ermordet wurden. Durch einen Schuss durch den Kiefer, der wahrscheinlich dem Zweck dienen sollte, die Identifizierung der Opfer anhand ihrer Zähne zu erschweren oder sogar unmöglich zu machen. Doch was spielte das für eine Rolle? Barnett war nur wegen des Mordes an Rebecca Moore angeklagt worden. Warum zum Teufel fragte er jetzt nach den anderen?
„Welche anderen?“ fragte er noch einmal, obwohl er die Antwort genau genommen gar nicht wissen wollte.
„Ach, was solls“, fand nun auch Barnett. Er spuckte ein Stück Fingernagel auf den Boden, verschränkte die Arme vor der Brust und schob die Hände unter die Achseln. „Sie wissen, dass ich keinen verdammten Penny besitze“, wechselte er das Thema. „Sie haben zwar gesagt, ich müsste Ihnen nichts zahlen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich schulde Ihnen was.“
Dieses Thema gefiel ihm schon besser. Wenn diese Morde tatsächlich auf sein Konto gingen, dann wollte er davon gar nichts wissen. Für ihn hatte es sich jedenfalls nur um einen Mord und einen Augenzeugen gehandelt. Der Augenzeuge hatte widerrufen, und damit war der Fall erledigt. Wenn Barnett etwas auf der Seele brannte, das er unbedingt loswerden wollte, dann sollte er sich doch einem Priester anvertrauen. Dass sich Barnett hingegen in seiner Schuld stehend fühlte, kam ihm sehr entgegen.
Zweifellos gehörte Jared Barnett zu den Menschen, die ungern mit einer offenen Rechnung lebten. Allein die Vorstellung, jemandem gegenüber verpflichtet zu sein, war ihm offenbar schon unangenehm. Und Max hatte natürlich auch davon gehört, wie Barnett nach der Verkündung des Todesurteils seinen vom Gericht bestellten Pflichtverteidiger, den armen James Pritchard, angefahren haben soll, dass er ihm nichts weiter schulde als ein Loch im Kopf.
Dennoch hatte er darauf gesetzt, dass Barnett sich ihm verpflichtet fühlen würde, und es freute ihn, dass seine Rechnung offenbar aufzugehen schien. „Ich denke, wir finden da einen Weg“, erwiderte er.
„Klar. Was immer Sie wollen.“
„Zunächst muss ich Sie allerdings warnen. Da draußen erwartet uns jetzt ein ziemlicher Medienzirkus.“
„Cool“, erwiderte Barnett und stand auf. Und genauso sah er auch aus – cool und emotionslos, wie er auch während des gesamten Wiederaufnahmeverfahrens gewirkt hatte. „Also, was zahlen die denn so?“
„Was meinen Sie?“
„Was rücken diese blutrünstigen Fernsehheinis raus für ein Interview?“
Max kratzte sich am Kopf, versuchte aber sofort, es so aussehen zu lassen, als striche er sich die Haare glatt. Die hätte er sich allerdings am liebsten gerauft. Unfassbar! Am Ende verdarb ihm dieser Hurensohn noch alles. Erwartete er tatsächlich, dafür bezahlt zu werden, dass sich die Medien für ihn interessierten?
Max gab sich alle Mühe, nicht aus der Haut zu fahren, und tat so, als sei es ihm völlig gleichgültig, ob Barnett Interviews gab oder nicht. Er durfte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass Barnett ihm damit einen Gefallen täte und die Sache als eine Art Gegenleistung ansah.
„Sie werden über Nacht berühmt werden, Mann“, sagte er lächelnd und schüttelte den Kopf, als könne er es selbst nicht glauben. „Ich habe Anfragen von NBC News, 60 Minutes, von Larry King und sogar Bill O’Reillys The Factor. Sie werden etwas bekommen, das man nicht für Geld kaufen kann. Ruhm. Aber ich kann auch verstehen, wenn Sie denen lieber sagen wollen, die sollen sich ins Knie schießen. Es liegt bei Ihnen, ganz wie Sie wollen.“
Er merkte, wie es in Barnetts Kopf zu arbeiten begann, aber er sagte nichts weiter, was seine gespielte Gleichgültigkeit noch glaubwürdiger wirken ließ. Er konzentrierte sich ganz auf seinen Atem, um nur nicht daran zu denken, wie sehr er diesen Triumph wollte und vor allem brauchte. Nur mit Mühe konnte er sich davon abhalten, die Fäuste zu ballen. Wag es bloß nicht, mir jetzt alles zu versauen, schrie er Jared innerlich an.
„Bill O’Reilly will mich tatsächlich in seiner Sendung haben?“
Max unterdrückte einen Seufzer der Erleichterung und erwiderte mit gespielter Ruhe: „Ja, morgen Abend. Aber wenn Sie nicht wollen, sage ich das ab. Ich kann denen erzählen, dass Sie mit dem ganzen Zirkus nichts zu tun haben wollen. Es ist ganz allein Ihre Entscheidung.“
„Dieser O’Reilly hält sich für einen ziemlich coolen Hund.“ Barnett grinste. „Ich hätte nichts dagegen, einigen von diesen Ärschen mal deutlich zu sagen, was ich von ihnen halte.“
Auch Max grinste jetzt. Vielleicht bekam er Barnett ja doch noch in den Griff. Zum ersten Mal, seit er ihm begegnet war, sah er ihm in die Augen. Sie waren dunkel und leer. Max war sich jetzt ganz sicher, dass Jared Barnett das Mädchen ermordet hatte. Er hatte es nicht nur gewusst, er hatte sogar darauf gesetzt.
Dienstag, 7. September
1. Kapitel
10.30 Uhr
Omaha, Nebraska: Gerichtsgebäude
Grace Wenninghoff hasste nichts mehr als dieses Warten. Sie hatte das Gefühl, die stickige Luft in Saal fünf würde sich wie ein nasses Handtuch um ihren Hals legen. Es waren zu viele Leute in dem Raum, die Hitze war schier unerträglich. Nur das gelegentliche Knarren eines Stuhls oder ein vereinzeltes Hüsteln unterbrachen die Stille. Angespannt und erwartungsvoll beobachtete die Menge, wie Richter Fielding scheinbar in aller Ruhe die vor ihm liegenden Akten studierte. Dabei ließ er sich Zeit und zeigte nicht das geringste Anzeichen von Unbehagen. Nicht eine einzige Schweißperle war auf seiner Stirn zu sehen.
Grace griff nach ihrer Wasserflasche und nahm einen großen Schluck. Komm schon, bringen wir es hinter uns, hätte sie den Richter gerne gedrängt, pochte jedoch nur mit dem Schreibstift auf ihren leeren Notizblock und unterdrückte den Impuls, mit dem Fuß denselben Takt zu schlagen. Ohne den Kopf zu heben sah der Richter sie über den Metallrand der unter buschigen grauen Brauen auf seiner Nasenspitze ruhenden Brille hinweg finster an. Grace legte den Stift auf den Block, und Richter Fielding widmete sich wieder seinen Akten.
Angeblich hatte die Verwaltung im gesamten Gebäude die Klimaanlage abgeschaltet, weil man nach dem langen Labor-Day-Wochenende nicht mehr mit solchen Temperaturen gerechnet habe. Grace konnte sich allerdings der Vermutung nicht erwehren, Richter Fielding habe sie gezielt in seinem Gerichtssaal ausschalten lassen, um ihnen allen den Schweiß auf die Stirn zu treiben. Fielding mochte es, Anwälte schwitzen und warten zu lassen. Das konnte kein gutes Omen sein, trotzdem versuchte Grace, optimistisch zu bleiben. So optimistisch, wie eine Anklägerin eben sein konnte, der die feuchte Luft die Frisur in etwas zu verwandeln drohte, das eher an das Fell eines Pudels erinnerte. Sie wusste, dass sie heute mehr als Optimismus brauchte.
Ihr Blick glitt über den Mittelgang hinüber zu Warren Penn, einem der Staranwälte der renommierten Kanzlei Branigan, Turner, Cross and Penn. Auch bei ihm konnte sie nicht ein Tröpfchen Schweiß entdecken, obwohl er tapfer seinen eleganten teuren Anzug trug. Wie machte er das bloß? Sie hatte gehofft, sein Klient, der wegen Mordes angeklagte Ratsherr Jonathon Richey, würde in Handschellen und im orangefarbenen Sträflingsoverall vorgeführt werden, doch Richey trug einen stahlblauen Anzug, ein tadellos gebügeltes weißes Hemd und eine rotblaue Krawatte. Der aalglatte Politiker sah nun ganz und gar nicht aus wie die blutrünstige Bestie, als die sie ihn hatte vorführen wollen. Und er wirkte nicht im Mindesten beunruhigt angesichts der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Er saß mit arrogantem Gesichtsausdruck da, und Grace fürchtete, dass er über sein Netzwerk politischer Kontakte bereits für den richtigen Ausgang des Verfahrens gesorgt hatte. Richter Fielding war bekannt dafür, den inneren Kreis der Macht zu schützen. Aber konnte er das auch vor Publikum tun und unter den wachsamen Augen der Medien?
Grace spürte, wie die Seidenbluse unter ihrem Jackett an ihrem Körper klebte. Mit einem prüfenden Blick vergewisserte sie sich, dass es keineswegs so schlimm aussah, wie es sich anfühlte. Was für ein Tag auch, um Seide zu tragen. Die Bluse war ein Geburtstagsgeschenk ihrer Großmutter Wenny, die sie seit ihrem sechsten Lebensjahr in Pink zu kleiden versuchte. Obwohl Wenny ihr versichert hatte, die Bluse sei purpurrot. Ihr deutscher Akzent hatte den Namen der Farbe nach etwas Erotischem, leicht Anrüchigem klingen lassen. Grace musste schmunzeln, als sie sich daran erinnerte.
Sie beobachtete Richter Fielding und suchte nach irgendeinem Hinweis, der darauf hindeuten mochte, dass es endlich weiterging. Doch Fielding blätterte weiter und setzte seine Lektüre in aller Ruhe fort, wobei er mit dem Zeigefinger unter den Zeilen entlangfuhr. Herrgott noch mal, dies war doch nur die Anhörung zur Festsetzung der Kaution! Bei diesem Tempo mochte sie sich gar nicht vorstellen, wie lange sich der Prozess hinschleppen würde.
Durch leichtes Massieren mit den Fingern versuchte sie die Verspannung zu lindern, die sie im Genick spürte. Das dreitägige Wochenende war zu kurz gewesen. Ihr Mann Vince hatte die Meinung vertreten, es sei kein Problem, eine Weile mit den gestapelten Kisten zu leben, doch er hatte gut reden. Morgen früh flog er in die Schweiz. Ein neuer Kunde hatte darauf bestanden, seinen amerikanischen Repräsentanten persönlich kennen zu lernen. Sie würde mit Emily also allein in dem Chaos zurückbleiben. Die unausgepackten Umzugskartons waren allerdings nicht der einzige Grund für ihre Verspannung.
Sie liebte ihr neues Zuhause, obwohl das Haus alles andere als neu war. Die viktorianische Villa war über hundert Jahre alt und groß genug, dass auch ihre Großmutter Wenny Platz bei ihnen finden konnte. Die Renovierung war ein reiner Albtraum gewesen. Horden von Handwerkern waren durch das Haus getrampelt und hatten dort, wo einmal Wände waren, Löcher, Dreck und Sägespäne hinterlassen.
Doch das war noch gar nichts verglichen mit dem, was ihr noch bevorstand. Denn jetzt galt es, ihre Großmutter davon zu überzeugen, dass es besser sei, bei ihnen einzuziehen. Sechzig Jahre hatte Wenny in ihrem kleinen, zugigen und von Mäusen zernagten Haus im Süden Omahas gelebt und dort ihre Kinder und dann ihre Enkelin großgezogen. Die wiederum sah es nun als ihre Pflicht an, sich um die störrische alte Dame zu kümmern.
„Miss Wenninghoff!“ bellte Richter Fielding und unterbrach Grace in ihren Gedanken.
„Ja, Euer Ehren.“ Sie erhob sich und widerstand dem Drang, sich über die feuchte Stirn zu wischen.
„Bitte fahren Sie fort“, sagte er in einem Ton, als habe sie die Unterbrechung verschuldet und halte das Verfahren unnötig auf.
„Wie ich bereits ausgeführt habe, und wie Sie auch dem Haftbefehl entnehmen können, wurde Mr. Richey am Flughafen Eppley festgenommen. Es besteht akute Fluchtgefahr, weshalb eine Freilassung gegen Kaution meines Erachtens nach nicht in Betracht kommt.“
„Euer Ehren, das ist lächerlich.“ Warren Penn unterstrich das letzte Wort mit einer theatralischen Geste. Dann stand er auf und trat vor den Tisch der Verteidigung, als benötige er für seine Erklärung zusätzlichen Raum. Grace war sich allerdings sicher, dass sein Auftritt allein dem Zweck diente, sie zu überragen.
„Mr. Richey ist Geschäftsmann“, fuhr er mit einer ausholenden Armbewegung fort. „Er wollte nicht mehr, als lediglich eine Geschäftsreise anzutreten, die schon vor Monaten vereinbart worden ist. Zum Beweis dafür habe ich hier seinen Terminkalender und die Auflistung seiner Telefongespräche.“ Er deutete auf einen Stapel Unterlagen auf seinem Tisch, machte jedoch keinerlei Anstalten, sie dem Richter vorzulegen. „Jonathon Richey ist nicht nur ein ehrenwerter Geschäftsmann in Omaha, sondern auch Ratsherr“, fügte er hinzu. „Darüber hinaus ist er Diakon seiner Kirchengemeinde und Präsident des örtlichen Rotary Clubs. Seine Frau, seine Kinder und seine fünf Enkel leben hier. Ein Fluchtrisiko besteht also eindeutig nicht. Wenn man all dies in Betracht zieht, Euer Ehren, bin ich sicher, dass Sie mir zustimmen werden, dass Mr. Richey gegen Hinterlegung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt werden sollte.“
Grace sah Richter Fielding nicken und wieder in den Akten blättern. Das war doch lächerlich, diesen Blödsinn konnte er ihm unmöglich abnehmen. Es sei denn, seine Entscheidung stand bereits fest und er suchte noch nach einer entsprechenden Begründung. Sie warf einen Blick auf Richey. Hatte es hinter verschlossenen Türen etwa bereits Verhandlungen oder sogar einen Deal gegeben? Richey wirkte entspannt, und die Hitze im Gerichtssaal schien ihm nichts auszumachen. Grace rieb sich den Nacken und spürte den Schweiß, der ihr von dort den Rücken hinunterlief.
„Euer Ehren.“ Sie wartete, bis Richter Fielding sie ansah. Dann zog sie aus ihren Akten einen Umschlag hervor und trat vor den Tisch der Anklage. „Wenn ich richtig informiert bin, ist Mr. Richey Eigentümer einer Firma für computergesteuerte Heizungsanlagen.“ Sie sah hinüber zu Warren Penn und wartete dessen zustimmendes Nicken ab. „Hier habe ich Mr. Richeys United-Airlines-Flugticket, das bei seiner Festnahme konfisziert wurde.“ Sie trat vor, um dem Richter den Umschlag mit dem Ticket zu übergeben. „Ich frage mich nun, Euer Ehren, welche Art von Heizung Mr. Richey wohl auf den Cayman Islands verkaufen wollte?“
Sie hörte, wie die Menge hinter ihr zu raunen und zu flüstern begann.
„Mr. Penn?“ Richter Fielding fixierte Richeys Verteidiger über den Rand seiner Brille hinweg. Zu Graces Enttäuschung zuckte Penn mit keiner Wimper.
„Es kommt häufig vor, dass sich Mr. Richey mit seinen Geschäftspartnern an einem neutralen Ort trifft, wenn der Kunde das bevorzugt.“
Grace hätte beinahe die Augen verdreht. Es wäre absurd, wenn Richter Fielding dieses Argument gelten lassen würde. Doch der blätterte bereits wieder in seinen Akten, als sei ihm in den bereits geprüften Unterlagen etwas entgangen.
Sie ging zu ihrem Platz zurück und musterte dabei Detective Tommy Pakula, der zwei Reihen hinter dem Tisch der Anklage saß. Er hatte sich für seine Aussage in Schale geworfen – Hemd, Krawatte und Jackett. Anstatt jedoch ihn jetzt in den Zeugenstand zu rufen, griff sie hinter ihren Stuhl und holte eine Reisetasche hervor.
„Euer Ehren“, sagte sie und hielt die Tasche so, dass Richter Fielding und vor allem die Anwesenden im Saal sie gut sehen konnten. „Es gibt da noch eine Merkwürdigkeit. Mr. Richey hatte diese Reisetasche bei sich, als die Detectives Pakula und Hertz ihn am Eppley Airport festgenommen haben. Wenn er nicht aus dem Land fliehen wollte, sollte uns Mr. Richey vielleicht das hier erklären.“ Grace zog den Reißverschluss auf und stülpte die Tasche um. Mehrere dicke Bündel Hundert-Dollar-Noten fielen auf den Tisch.
Sofort erfüllte ein Raunen und Tuscheln den Saal, und mehrere Reporter stürzten zur Tür hinaus, um ihre Redaktion anzurufen. Doch Warren Penn schüttelte nur den Kopf, als hätte er auch für das Geld eine Erklärung. Grace ließ den Blick durch den Raum schweifen und bemerkte Jonathon Richeys Miene. Von der arroganten Gelassenheit, die er bisher an den Tag gelegt hatte, war nun nichts mehr zu sehen.
„Ruhe bitte!“ rief Richter Fielding in den Saal, verzichtete aber auf den Einsatz des Hammers, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Es schien ihm zu gefallen, dass er den Saal allein durch die Kraft seiner Stimme zum Schweigen bringen konnte.
„Euer Ehren“, begann Penn, doch Richter Fielding gebot ihm mit erhobener Hand Einhalt.
„Die Kaution wird auf eine Million Dollar festgesetzt.“ Er stand auf und fügte hinzu: „Die Verhandlung ist geschlossen.“ Dann hastete er aus dem Saal, ohne Warren Penn Gelegenheit zu einer Erklärung oder für weitere Argumenten zu geben.
Grace verzichtete auf einen Blick in Richtung der Verteidigung und packte das Geld zurück in die Reisetasche. Ein Gewirr von Stimmen erfüllte den Saal, begleitet vom Geräusch rückender Stühle. Sie musste wohl kaum befürchten, draußen von Reportern belagert zu werden, die stürzten sich jetzt auf Jonathon Richey. Das war eben der Preis, den man zahlte, wenn man sich als aufrechte Stütze der Gesellschaft ausgab und bei einer Sauerei erwischt wurde.
„Ich hoffe nur, dass nichts fehlt.“ Sie blickte auf und sah Detective Pakula vor sich stehen.
„Danke, dass Sie gekommen sind.“
Er nickte, und sie kannte ihn gut genug, um es dabei bewenden zu lassen. Er mochte es nicht, wenn man viel Aufhebens um etwas machte, das er für selbstverständlich hielt.
„Ich habe einen Zeugen gefunden, der vielleicht bereit ist, gegen Richey auszusagen.“
„Vielleicht?“
„Es braucht noch etwas Überzeugungsarbeit. Er will nicht aussagen, wenn die Möglichkeit besteht, dass Richey freigesprochen wird.“
„Es wird in dieser Sache keinen Freispruch geben“, erwiderte sie und schob die letzten Bündel in die Tasche. Sie wusste, worauf Pakula hinauswollte und mochte es nicht hören.
„Sie wissen es, und ich weiß es, und das versuche ich ihm klar zu machen.“ Er sah sich um und vergewisserte sich, dass niemand in Hörweite war. „Um unsere Glaubwürdigkeit steht es momentan nicht gerade gut, solange dieser Mistkerl von Barnett in jeder verdammten Talkshow auftritt und behauptet, das Omaha Police Department hätte ihn reingelegt.“
„Lassen Sie den nur reden. Früher oder später macht er einen Fehler, und dann nagele ich ihn fest. Aber dann für immer.“
„Verlassen Sie sich auf mich, wenn es so weit ist.“
Grace wusste, dass Barnetts Freispruch in dem Wiederaufnahmeverfahren Pakula ebenso an die Nieren gegangen war wie ihr. Während der vergangenen Monate war sie den Fall immer wieder durchgegangen, um weiteres Belastungsmaterial zu finden, doch vergeblich. Vor fünf Jahren hatte sie alles darangesetzt, um Barnett hinter Gitter zu bringen. Sie war felsenfest davon überzeugt, dass er die siebzehnjährige Rebecca Moore an jenem kalten Winternachmittag mit dem Angebot, sie trocken nach Hause zu bringen, in seinen Wagen gelockt hatte. Er war mit ihr an einen abgelegenen Ort gefahren, hatte sie vergewaltigt und dann mit einem Messer auf sie eingestochen. Anschließend hatte er ihr in den Kopf geschossen – durch den Kiefer, um die Identifizierung seines Opfers zu verhindern.
Rebecca Moore war wahrscheinlich nicht das einzige Mädchen, das Barnett auf dem Gewissen hatte. Vier weitere Frauen waren auf dieselbe bestialische Art und Weise umgebracht worden, jeweils im Abstand von zwei Jahren. Grace und Pakula waren davon überzeugt, dass in allen Fällen Barnett der Mörder war. Aber außer Indizien hatten sie nichts gegen ihn in der Hand gehabt. Nur in Rebecca Moores Fall konnten sie eine Verbindung zwischen Opfer und Täter herstellen. Mit Danny Ramerez hatten sie einen Augenzeugen, der gesehen hatte, wie das Mädchen am Nachmittag ihres Verschwindens in einen schwarzen Pick-up gestiegen war. Und er konnte bestätigen, dass Jared Barnett am Steuer gesessen hatte. Seine Aussage war überzeugend gewesen und seine Beschreibung Barnetts so genau, dass für die Geschworenen keinerlei Zweifel bestanden. Doch dann, fünf Jahre später, hatte Danny Ramerez plötzlich behauptet, er sei an jenem Nachmittag nicht einmal vor der Tür gewesen gewesen. Ohne seine belastende Aussage war Barnett frei. So einfach ging das.
Grace sah hinüber zum Tisch der Verteidigung. Penn und Richey versuchten gerade, sich durch den Pulk von Menschen einen Weg zum Ausgang zu bahnen.
Und dann entdeckte sie ihn.
Jared Barnett stand in der hinteren Reihe und wartete scheinbar geduldig darauf, ebenfalls den Saal verlassen zu können. Er wirkte völlig unauffällig, ganz wie ein gewöhnlicher Zuschauer.
„Wenn man vom Teufel spricht“, sagte sie zu Pakula, der Barnett nun ebenfalls bemerkt hatte.
„Dieser Mistkerl“, raunte er. „Ich habe ihn letzte Woche schon mal draußen im Treppenhaus gesehen. Er kann es wohl nicht lassen, sich hier rumzutreiben, was?“
Auch Grace hatte ihn bereits in der vergangenen Woche gesehen, sogar zweimal. Zuerst in dem Cafe auf der anderen Straßenseite gegenüber des Gerichtsgebäudes. Und dann noch einmal, als sie gerade ihre Wäsche in die Reinigung brachte. Sie hatte versucht sich einzureden, das sei eben Jared Barnetts Art, ihnen allen eine Nase zu drehen, und dass er es nicht etwa auf sie abgesehen habe. Doch bevor Barnett durch die Tür verschwand, drehte er sich noch einmal zu Grace um und grinste.
2. Kapitel
19.30 Uhr,
Logan Hotel
Jared Barnett lauschte auf ein Geräusch, doch in dem Schacht hinter der Tür blieb es still. Wo zum Teufel blieb der verdammte Fahrstuhl bloß?
Darauf bedacht, nicht aus dem Schatten zu treten, lehnte er sich gegen die Wand und ignorierte die kleine Gipslawine, die er mit seiner Schulter auslöste. Niemand hatte ihn beim Betreten des Hauses gesehen. Außer dieser von Crack ausgemergelten Hure mit den fettigen blonden Haaren und dem glasigen Blick, die sich nicht mal erinnern würde, welcher Tag heute war. Wie sollte die sich ein Gesicht merken können?
Vom anderen Ende des Flurs drang ihm Essensgeruch in die Nase. Spinat, ihm wurde fast übel. Er musste dabei immer daran denken, wie ihn sein Stiefvater gezwungen hatte, den Teller leer zu essen. Einmal hatte er es gewagt, sich zu widersetzen, und da hatte ihm der Mistkerl das Gesicht in die grüne Pampe gedrückt. Aber irgendwie passte der Geruch hierher, zu dem Gestank nach Hundepisse, zu dem schäbigen Teppichboden und den Kakerlaken, die überall umherkrabbelten und in den Ritzen und unter den Türen verschwanden. Die ideale Absteige für einen wie Danny Ramerez.
Jared verlagerte das Gewicht vom linken Fuß auf den rechten und nahm die beiden Papiertüten in die andere Hand. Das Hühnchen würde kalt sein, aber das störte ihn nicht. Er war hungrig, und er liebte chinesisches Essen über alles, selbst wenn es kalt war. Er hätte die Tüten gerne abgestellt, doch ließ er das lieber bleiben. Die verdammten Kakerlaken würden sich in Sekundenschnelle darüber hermachen.
Jared sah auf seine Armbanduhr und musste die Augen zusammenkneifen, um die Zeiger in dem Dämmerlicht zu erkennen. Ramerez hatte sich wohl verspätet. Warum zum Geier ausgerechnet heute? Er war ihm während der letzten drei Abende gefolgt, und er wusste, dass man fast die Uhr danach stellen konnte, wann er nach Hause kam. Und ausgerechnet heute musste der Bastard zu spät kommen. Doch dann hörte er das Quietschen und Rucken des Fahrstuhls. Er war auf dem Weg nach oben.
Abwartend blieb Jared im Halbdunkel stehen. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die ächzenden Zugseile den Fahrstuhl geräuschvoll in den fünften Stock befördert hatten, und Jared war noch immer froh, dass er die Treppe genommen hatte. Dann öffnete sich die Tür.
In dem Schummerlicht wirkte Danny Ramerez kleiner, als Jared ihn in Erinnerung hatte. Es sah lächerlich aus, wie er mit hastigen Trippelschritten über den Flur auf sein Zimmer zu lief. Als er die Tür erreicht hatte und den Schlüssel ins Schloss steckte, trat Jared aus dem Schatten.
„He, Mann!“ rief er. Ramerez nickte, ohne sich umzudrehen. „Wie gehts denn so, Danny?“
Erst jetzt drehte Ramerez sich verblüfft um und riss die Augen auf, als er Jared erkannte.
„Ich habe was zu essen mitgebracht“, sagte der und hielt die Tüte hoch, um Danny zu beruhigen. „Chinesisch.“
„Was wollen Sie denn hier?“
„Was meinst du denn? Sag bloß, du hast nicht damit gerechnet, dass ich mal vorbeikomme, um Hallo zu sagen?
Ramerez bekam endlich die Tür auf, doch dann blieb er unschlüssig davor stehen.
„Du hast mir einen großen Gefallen getan“, fügte Jared hinzu und grinste. „Ich wollte mich nur bedanken.“
Ramerez musterte ihn misstrauisch und suchte dann Jareds Augen, als würde er darin irgendwelche Antworten finden. Dann zuckte er die Achseln. „Sie schulden mir nichts. Ihr Freund mit den roten Haaren hat mich schon bezahlt. Hat sogar noch einen Laptop draufgelegt.“
Jareds Grinsen wurde breiter. Es brauchte nicht viel, jemanden wie Danny Ramerez zu kaufen, und genau aus diesem Grund konnte er ihm nicht trauen. „He, Mann, ich hab Hühnchen mitgebracht und ein paar Frühlingsrollen. Keinen Hunger?“
Er schwenkte die Tüten verheißungsvoll und machte keinerlei Anstalten zu gehen. Schließlich zuckte Ramerez abermals die Achseln und bedeutete ihm, mit in das Zimmer zu kommen, das wie eine Mischung aus Trödelladen und Müllhalde aussah. Ein Haufen schmutziger Wäsche lag auf einem fadenscheinigen Sessel, und es roch entweder nach ungewaschenen Socken oder verfaulten Eiern. Auf dem Fußboden lagen Zeitschriften und Comic-Hefte herum, in den Regalen stapelten sich leere Bierflaschen und – dosen, dazwischen zusammengeknüllte Fast-Food-Verpackungen. Auf dem Kaffeetisch lag ein offener Pizzakarton mit zwei übrig gebliebenen Stücken, deren Belag plötzlich lebendig zu werden und aus der Schachtel zu huschen schien.
Halbherzig schob Ramerez zur Seite, was im Wege stand, als wolle er für seinen Gast schnell etwas aufräumen. Während er den gröbsten Müll einsammelte, holte Jared einen großen schwarzen Müllsack aus einer seiner Tüten und begann ihn auf dem abgetretenen Linoleum inmitten des Raums auszubreiten. Ramerez hielt inne und sah ihm zu.
„Was tun Sie da?“
„Ich will hier keine Sauerei anrichten“, erklärte Jared.
Ramerez lachte. „Sie machen Witze, was?“
Er kam herüber, betrachtete fragend den Plastiksack auf dem Fußboden und setzte schließlich einen Fuß darauf, tastend, als vermute er eine Falltür darunter. Jared zog das Messer aus der Tüte und durchtrennte ihm mit einem schnellen kräftigen Schnitt die Kehle. Blut spritzte auf den Plastiksack zu Ramerez’ Füßen.
Reflexartig griff Ramerez nach der Wunde. Seine Finger glitten in das auseinander klaffende Fleisch, als wolle er es zusammenhalten. Mit weit aufgerissenen Augen stierte er Jared an. Schock und Entsetzen verzerrten sein Gesicht, dann brach er zusammen.
Jared sah sich in dem Raum um und entschied sich für den Sessel. Er warf die Kleider auf den Boden, vergewisserte sich, dass sich darunter keine Kakerlaken eingenistet hatten, nahm dann die andere Tüte und setzte sich. Er fingerte die Plastikgabel heraus und machte sich über das Hühnchen süßsauer her.
Mittwoch, 8. September
3. Kapitel
7.00 Uhr
Omaha, Nebraska
Melanie Starks beschleunigte ihre Schritte. Hinter dem Turm der St. Cecelia Kathedrale kam gerade die Sonne hervor. Die Tage waren bereits deutlich kürzer geworden, der Sommer neigte sich seinem Ende zu, schien aber heute noch einmal zeigen zu wollen, wozu er fähig war. Sie war gerade erst losgegangen, und schon jetzt fiel ihr das Atmen schwer. Trotz der frühen Stunde war es so schwül, dass sie dachte, man müsse die Luft schneiden können.
Sie drehte sich um und sah zurück. Früher hatte sie Sonnenaufgänge gehasst, aber inzwischen mochte sie das Schauspiel. Heute allerdings bereitete ihr der Sonnenaufgang ein ungutes Gefühl. Als ihr eine Schweißperle den Rücken hinablief, spürte sie sogar ein leichtes Schaudern. Dort, wo sich die dunklen Gewitterwolken aufzutürmen begannen, war der Himmel grau wie ein Grabstein, unterbrochen von blutroten Streifen, eine geradezu unheimliche Kombination. Sie musste daran denken, was ihre abergläubische Mutter oft prophezeit hatte: „Morgenrot, Unheil droht. Abendrot, keine Not.“
Das Wetter schien ihre innere Unruhe noch zu verstärken, ihre Enttäuschung und Frustration. Ach zum Teufel, warum nannte sie es nicht beim Namen – ihre Wut. Ja, genau das war es. Sie war wütend, stinksauer. Jared war erst seit zwei Wochen draußen, und schon lief alles wieder genauso wie früher.
Sie war sauer, dass sie ihren morgendlichen Marsch seinetwegen nicht zur gewohnten Zeit machen konnte. Was für eine Anmaßung, seine Belange über ihre zu stellen! Gestern Abend hatte er angerufen und die Nachricht hinterlassen, sie solle ihn treffen, zum Frühstück. Das war typisch für ihn, er zitierte sie zu sich, als könne er sie immer noch bevormunden wie ein Kind: „Wir treffen uns im Cracker Barrel. Die Zeit ist reif.“
„Die Zeit ist reif“, äffte sie ihn leise nach. Sie hatte keine Ahnung, was zum Henker er damit meinte. Auch das war typisch. Immer tat er so geheimnisvoll, als wären sie Kinder, die etwas Verbotenes ausheckten. Sie wusste nur, dass er irgendetwas vorhatte. Etwas Großes, hatte er behauptet, und mehr wollte er nicht sagen. So war Jared eben, ein Egomane, der ständig den Ton angeben musste. Fragen oder Bedenken akzeptierte er nicht. So war es immer gelaufen, auch mit dieser Rebecca Moore damals. Jared hatte es nicht mal für nötig gehalten, ihr irgendetwas zu erklären. Nur, dass die Polizei auf einem völlig falschen Dampfer sei, hatte er immer wieder stur behauptet. Melanie wusste allerdings, dass so etwas durchaus passieren konnte. Vor ein paar Jahren hatte sie es ja selbst erlebt.
Zügig ging sie die Straße entlang und versuchte, sich nicht weiter in ihre Wut hineinzusteigern. Aber sie konnte es einfach auf den Tod nicht ausstehen, wenn Jared ihr das Gefühl vermittelte, sie sei ihm etwas schuldig. Und dass sie während seiner Verhandlung nicht für ihn da gewesen war, machte es nicht einfacher.
Jedenfalls sah es ganz so aus, als hätte sich in den fünf Jahren, die er im Gefängnis gewesen war, nichts geändert. Was – jedenfalls was sie betraf – natürlich nicht stimmte. Sie hatte sich verändert. Wenigstens glaubte sie das, obwohl ihr diesbezüglich nun Zweifel kamen. Warum tat sie schon wieder, was er von ihr verlangte, traf sich mit ihm, ohne Fragen zu stellen? Seinetwegen war sie von ihrem täglichen Ritual abgewichen, das für sie zu einer Art Ersatzdroge geworden war. Zuerst hatte sie sich das Rauchen abgewöhnt und das Nikotin durch Kaffee ersetzt. Vier Tassen am Morgen hatten ihr über den Nikotinentzug hinweggeholfen, und nun ersetzte ein drei Meilen langer Fußmarsch jeden Morgen das Koffein.
Sie hatte selbst erkannt, dass bei ihr eine Sucht die andere ablöste. Jeden Tag ging sie dieselbe Strecke, immer zur selben Zeit und sogar im selben Tempo. Aber jetzt musste sie einen Schritt zulegen, um nachher pünktlich zu sein. Sie fand sich damit ab, aber eine kürzere Strecke wollte sie seinetwegen nicht gehen. Sie straffte die Schultern, als sei dieser trotzige Gedanke bereits eine Auflehnung gegen ihren Bruder. Früher hatte sie es nie geschafft, sich gegen ihn durchzusetzen. Aber Jared musste doch endlich begreifen, dass sie nicht mehr das kleine Mädchen war, das er einfach so herumkommandieren konnte. Sie war eine erwachsene Frau, hatte einen Sohn. Sie hatte sich dem Leben gestellt, während es ihr vorkam, dass Jared nie erwachsen wurde. Nach seiner Entlassung war er sogar wieder zu ihrer Mutter gezogen.
Etwas Dümmeres hätte er kaum tun können. Dass ihre Mutter nicht einfach nur abergläubisch, sondern verrückt war, hatten sie schon als Kinder festgestellt, als sie anfing, sich der schwarzen Magie hinzugeben. Vielleicht erklärte das, warum sie an diese beiden Drecksäcke geraten war, von denen der eine ihr und der andere Jareds Vater war. Dass ihre Mutter durchgedreht war, ertrug Melanie leichter als eine andere Erkenntnis, die nicht weniger zutreffend war. Sie war schlicht und einfach stockdumm. Vielleicht war das der Grund für Jareds Problem. Ihr kam die Idee, ihn damit aufzuziehen, dass er nicht nur die verrückten Gene ihrer Mutter geerbt habe. Und sie wusste sofort, dass sie niemals wagen würde, ihn zu provozieren.
An der Nicholas Street bog Melanie links in die 52. Straße ab. Sie mochte die Gegend um den Memorial Park, ein Viertel mit großen Stadtvillen und gepflegten Rasenflächen. Kein Gartenzwerg weit und breit. Sie musste schmunzeln, als sie an den jüngsten Tick ihres Sohnes dachte, Gartendekorationen zu klauen, was sie gleichermaßen ärgerte wie amüsierte. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Und schließlich hatte sie ihm eine Menge beigebracht. Solange er noch klein war, hatte sie ihre gemeinsamen Diebestouren als Spiel ausgegeben. Jetzt wurmte es sie, dass Charlie das Stehlen ungeachtet aller Risiken und Gefahren offenbar immer noch als ein Spiel ansah. Er war wirklich ein guter Schüler gewesen, vielleicht sogar zu gut.
Er war gerade acht, als sie ihn das erste Mal mitgenommen hatte. In dem Supermarkt an der Center Street klauten sie aus der Tiefkühltruhe Hackfleisch-Packungen – arbeiteten sich aber schnell zu T-Bone-Steaks hoch – und ließen sie in seinem Schulranzen verschwinden. Charlie war bald so geschickt, dass sogar sie nicht merkte, wie er die Twinkies oder Bazooka-Kaugummis mitgehen ließ, bis sie später neben ihrer Beute auf dem Küchentisch landeten. Er war wirklich ein Naturtalent. Mit seinem blassen Babygesicht und dem leicht schiefen Lausbubengrinsen kam er selbst heute noch, neun Jahre später, fast immer durch.
Sie hatte damit angefangen, weil sie sich mit ihren lausigen Gelegenheitsjobs nicht über Wasser halten konnte. Um zu überleben. Und was machte es schon, wenn Charlie diese albernen Gartenzwerge stahl, solange er auch genügend Lederjacken oder CD-Player anschleppte, damit sie die Miete zahlen konnten. Er schien den Nervenkitzel zu brauchen, und so sagte sie auch nichts, als er damit anfing, Autos kurzzuschließen, bevorzugt Saturns. Auch so ein Tick. Vielleicht war es seine sorglose Unbefangenheit, die ihn davor bewahrte, geschnappt zu werden. Sie fürchtete allerdings, es hatte mehr mit Glück zu tun. Ihre Glückssträhne hielt nun schon eine ganze Weile, aber eines Tages würde sie zu Ende sein. Doch diesen Gedanken verscheuchte sie lieber.
Glück und günstige Gelegenheiten, das waren ihre Fahrkarten aus dem stinkenden Drecksloch gewesen, in dem sie aufgewachsen war. Vor zehn Jahren war sie nach Dundee gezogen, ein netter Stadtteil, in dem überwiegend Familien wohnten. Es war ein gutes Viertel, wenn auch längst nicht so nobel wie dieses hier, dachte sie und sah sich um. Ob die Menschen, die hinter diesen großen, imposanten Türen lebten, sie verstehen könnten? Wohl kaum. Sie führte ein Leben, das sich diese Leute mit ihren polierten schwarzen BMWs und Lexus-Geländewagen in den Einfahrten sicher nicht einmal vorstellen konnten. Hier fehlte nirgends eine Kühlerhaube, und an keiner Karosse entdeckte sie einen Rostfleck. Hier war die Welt noch in Ordnung.
Sie entdeckte nur einen einzigen Pick-up am Straßenrand, einen Chevy, und noch bevor sie den ramponierten Anhänger sah, wusste sie, dass er zu einem Gärtnerei-Service gehörte. Dann sah sie die beiden jungen Männer, die auf den Knien in dem Vorgarten des Hauses arbeiteten. Mit großen Scheren schnitten sie das Gras entlang des makellos weißen Gartenzauns. Offenbar war es nicht möglich, dem wuchernden Grünzeug mit ihren technischen Gerätschaften beizukommen. Oder sie hatten einfach Angst, sonst das Holz zu beschädigen.
Beinahe hätte Melanie den beiden Jungs – sie mochten kaum älter sein als Charlie – ein Lächeln zugeworfen, doch sie unterdrückte den Impuls. Denn sonst hätten sie sofort gewusst, dass sie nicht hierher gehörte, dass sie es sich niemals würde leisten können, jemanden für die Pflege eines Gartens zu bezahlen. Also sah sie unbeteiligt geradeaus, als sie an ihnen vorbeiging, als würde sie die beiden Jungs mit den bloßen schwitzenden Oberkörpern nicht zur Kenntnis nehmen.
Sie sah auf ihre Armbanduhr, eine elegante Movado mit schwarzem Zifferblatt und einem einzelnen Diamanten, die Charlie ihr zum Muttertag geschenkt hatte. Sie fragte schon längst nicht mehr nach, woher er die Sachen hatte. Unwillkürlich kam ihr der Gedanke, dass, wenn schon nicht sie selbst, wenigstens ihre Uhr in diese Gegend passte.
Dann erreichte sie den Ahorn, dem das Gewitter in der letzten Woche arg zugesetzt hatte. Er hatte einmal eindrucksvoll ausgesehen, doch jetzt schien nur noch sein Stamm intakt zu sein. Der Sturm hatte die Äste abgerissen, und die, die übrig geblieben waren, wirkten nun wie zwei Arme, die sich hilflos in Richtung Himmel streckten. Jemand hatte ein Pappschild an den Stamm genagelt. „Hoffnung ist das Federding“, stand darauf, und dann in kleinerer Schrift: „Emily Dickinson“.
Melanie musterte das Haus, zu dem der Baum gehörte, ohne ihren Schritt zu verlangsamen. In Gedanken wiederholte sie den Satz, „Hoffnung ist das Federding“, und schnaubte dann verächtlich. Was zum Teufel sollte das heißen? Und außerdem, was wussten Leute, die hier lebten, schon von Hoffnung? Welche Probleme konnten die schon haben, die sich nicht mit Geld regeln ließen?
Sie dachte daran, was Jared immer sagte: Leute, die Geld haben, haben nicht die geringste Ahnung von den Leuten, die keins haben.
Melanie hielt inne, drehte sich um und sah zu dem Baum zurück. Selbst aus einem Block Entfernung noch stach er heraus, als gehöre er nicht in diese malerisch perfekte Umgebung.
„Hoffnung ist das Federding“, wiederholte sie noch einmal und verstand den Satz immer noch nicht. Wollte da jemand witzig sein? Oder etwa kundtun, dass er über dieses hässliche Ding in seinem Garten erhaben war? Es konnte doch niemand ernsthaft glauben, dass Hoffnung den Ahorn retten würde. Aber warum verschwendete sie überhaupt ihre Gedanken daran? Eins wusste sie jedenfalls mit Sicherheit: Nur Leute in solchen Häusern mit ihren BMWs vor der Tür konnten es sich leisten, auf Hoffnung zu vertrauen. Menschen wie sie, Charlie und Jared verließen sich lieber auf ihr Glück. Mit etwas Glück konnte man sein Leben verändern. Sie und Jared waren aus demselben stinkenden Loch gekrochen. Aber das war auch das Einzige, das sie verband.