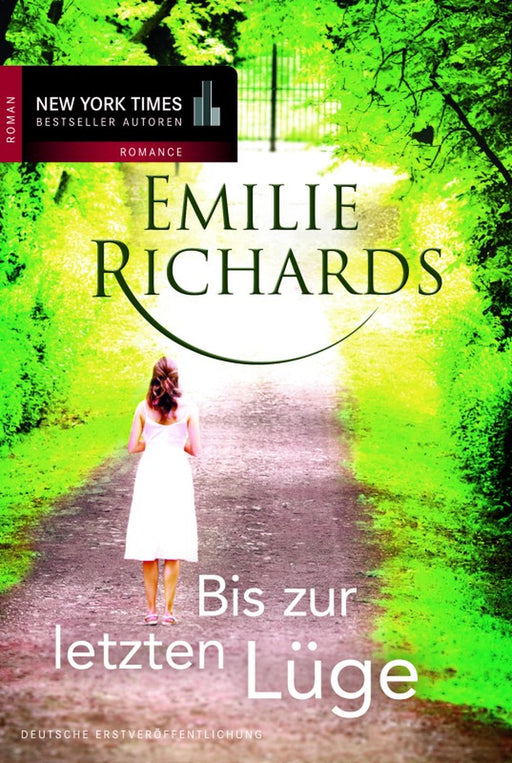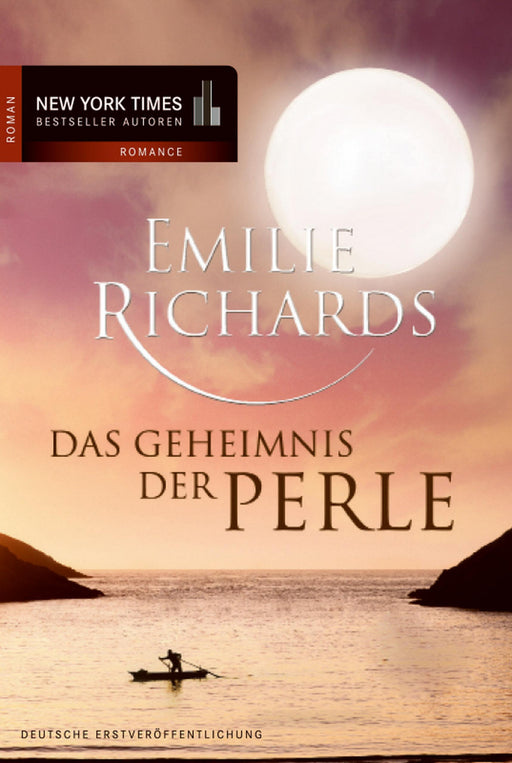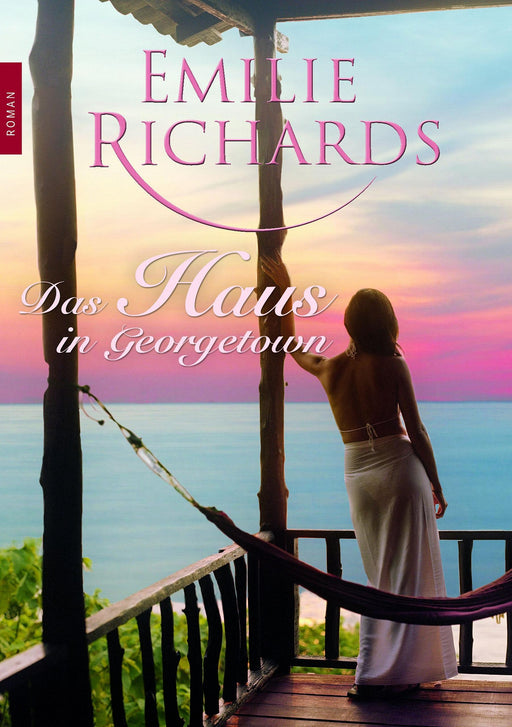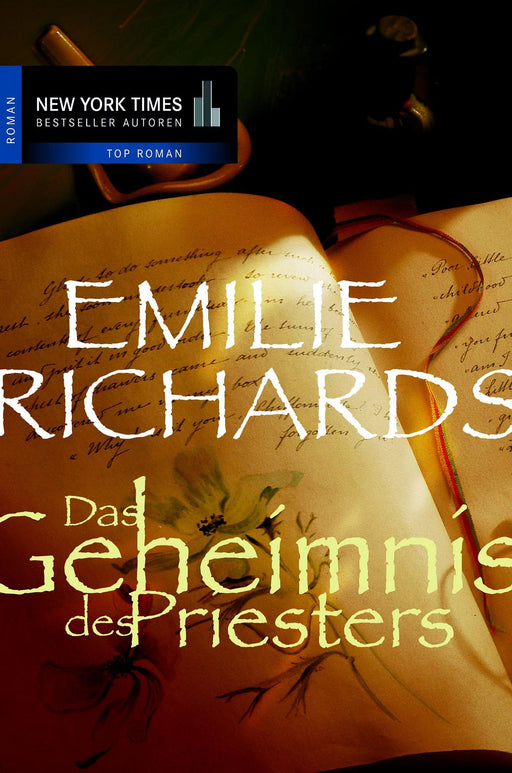Das Geheimnis des Priesters
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Das Leben der irischen Einwanderer in Cleveland ist einfach und hart. Bei einem guten Glas Whiskey suchen die Bewohner Trost und Vergessen in Megans Kneipe, dem "Whiskey Island". Doch die Vergangenheit ruht nicht: Mit dem Fund eines Skeletts werden alte Wunden wieder aufgerissen, und es ist Megans Leben, das plötzlich bedroht scheint. Ein sorgsam gehütetes Geheimnis wartet auf seine Enthüllung, und es ist ausgerechnet ein ehemaliger Priester, der Megan mit seinem Mut - und seiner Liebe - zur Seite steht.