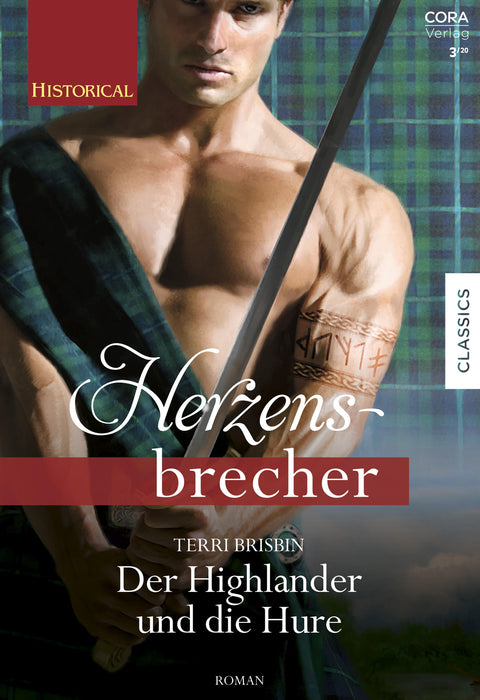1. KAPITEL
Man erzählt sich, ihre Brüste seien so üppig, dass sie die Hand eines Mannes füllen.“
„Oder seinen Mund!“, rief ein anderer aus dem Hintergrund.
„Ich habe gehört, dass ihre Beine den Bauch eines Mannes umschließen und ihn in den Himmel tragen können.“ Das kam vom Jüngsten aus der Gruppe. „Und ihr Haar fällt in pechschwarzen Wellen bis zur Taille hinunter.“ Duncan hätte schwören können, dass er einen sehnsüchtigen Unterton aus der Stimme des Jungen heraushörte, der kurz davor stand, ein Mann zu werden.
„Nein, es ist so hell wie das blondeste Blond“, tönte es aus einer anderen Ecke.
„Mir ist zu Ohren gekommen, dass es rot ist … so wie das von Hamish!“, konterte Travis.
Alle lachten darüber, aber das Gelächter verstummte schnell wieder, und Duncan wurde klar, dass jeder von ihnen das Gleiche dachte.
„Aye, Junge“, rief Hamish und warf den Kopf in den Nacken, sodass sein kastanienrotes Haar über seine Schultern fiel. „Und mir hat man über sie erzählt, dass ihre Haare das Einzige waren, was ihren Körper bedeckte, als sie mit zwei oder gar drei Männern in ihrem Bett von dem alten Laird erwischt wurde. Ihrem Vater.“
Duncan fühlte sich versucht, sie zu mahnen, nicht noch wüstere Geschichten zum Besten zu geben, doch in dem Moment begann Hamish zu singen. Es war eine gefällige Melodie, die ihnen allen vertraut war. Hamish jedoch veränderte hier und da ein Wort, und schon wurde daraus ein anstößiges Lied, das sich über die Geschicklichkeit im Bett und die körperlichen Vorzüge der Frau aus dem Robertson-Clan ausließ, die auch die Robertson-Hure genannt wurde. Duncan ließ das ausgelassene Treiben noch für kurze Zeit zu, dann war der Moment gekommen, um einzuschreiten.
„Es ist eine Sache, wenn solche Dinge unter uns zur Sprache kommen, aber solches Gerede könnte auf der anderen Seite all meine Bemühungen zunichtemachen, mit dem Bruder der jungen Frau zu verhandeln“, erklärte er und sah nacheinander jedem der Anwesenden in die Augen, um zu unterstreichen, wie ernst es ihm war. „Verschwiegenheit ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge, und ich erwarte von euch, dass ihr eure Zunge im Zaum haltet. Sie ist entehrt, und sie wurde in Verbannung geschickt. Mehr gibt es über sie nicht zu sagen.“
Die Männer hinter ihm grummelten etwas vor sich hin, doch er wusste, sie würden seine Befehle befolgen. Aus eben diesem Grund hatte er sie ausgewählt – er brauchte Männer, auf deren Gehorsamkeit er zählen konnte, sobald die Verhandlungen begonnen hatten, die möglicherweise in Streit ausarten würden. Ein falsches Wort, eine unbedachte Bewegung, allein schon ein unziemlicher Blick, und die monatelange Vorbereitung würde vergebens gewesen sein.
Die Sonne brach in dem Moment durch die Wolkendecke, als die Männer den Punkt auf ihrem Weg erreichten, von dem aus sie das Tal überblicken und bis dorthin sehen konnten, wo die Ländereien der Robertsons begannen. Ländereien, die sich meilenweit entlang der Grampian Mountains bis nach Perth an der Ostküste Schottlands erstreckten. Ländereien, auf denen sich etliche Dörfer befanden und viele Hektar dichter Wald standen, durch die Flüsse verliefen, die reich an Fischen waren. Ländereien, die aus gutem Ackerboden und hohen Bergen bestanden. Und Ländereien, die Tausenden von Kriegern eine Heimat bot, tapferen Männern, die sich vor Jahrzehnten hinter Robert the Bruce gestellt hatten.
Ja, die Robertsons waren mit reichem Land und mit gut bewaffneten Männern gesegnet, was die erwogene Allianz umso verlockender machte. Einen Moment lang schirmte Duncan seine Augen vor der Sonne ab und suchte das Tal nach der Straße ab, die zur Festung führte.
„Ihr könnt hier euer Lager aufschlagen und auf meine Rückkehr warten“, sagte Duncan, als er sich zu seinen Leuten umdrehte. „Länger als drei Tage wird es nicht dauern.“
„Er will ja bloß die Hure für sich allein haben“, warf Donald lachend ein.
Es gelang Duncan nicht, den Fluch zu unterdrücken, der ihm ob dieser Bemerkung über die Lippen kam. Die Männer nickten, um ihm zu zeigen, dass sie seine Warnung verstanden hatten. Nur Hamish nicht. Der verdammte Kerl zwinkerte ihm stattdessen zu. Hamish wusste zu gut um Duncans derzeitige Unzufriedenheit mit dem Leben und mit den Frauen, um sich zu einer entsprechenden Bemerkung hinreißen zu lassen, und war klug genug, es bei diesem Zwinkern zu belassen.
„In drei Tagen reitet ihr um Mittag zum westlichen Rand des Dorfs. Dort werden wir uns wiedersehen“, erklärte Duncan und wendete sein Pferd, damit es der Straße zu dem entfernt gelegenen Dorf folgte.
Seine Männer kannten ihre Pflichten, und er zweifelte nicht daran, dass sie bis zum Einbruch der Dunkelheit ein kleines, unauffälliges Lager errichtet haben würden. Bis dahin hätte er ein gutes Stück des Wegs zurückgelegt, zu seinem Treffen mit jenem Mann aus dem Clan der Robertsons, der ihn mit Neuigkeiten über den Clan und seinen neuen Laird versorgt hatte, die man sonst so leicht nicht in Erfahrung bringen konnte.
Der Tod des alten Laird vor zwei Jahren war für Duncan die Gelegenheit gewesen, Verhandlungen in die Wege zu leiten. Allerdings wäre es ohne die harte Arbeit, die Entschlossenheit und den bedingungslosen Rückhalt durch Connor MacLerie niemals so weit gekommen. Zwischen den Bäumen hindurch folgte er dem Verlauf eines Flusses, der talwärts und damit auf die Ländereien der Robertsons führte. Nach den Karten zu urteilen, die er sich angesehen und eingeprägt hatte, musste er in gut zwei Stunden ein Dorf erreichen.
Während er sein Pferd vorantrieb, ging er noch einmal seinen Plan durch und rief sich die Fragen, die er Ranald stellen wollte, ebenso ins Gedächtnis wie die Bedingungen für den Vertrag, den er im Auftrag seines Lairds mit sich führte. Reaktionen auf veränderte Forderungen und Vorschläge waren längst überlegt worden. Denn Duncan glaubte nicht nur daran, sondern wusste auch aus Erfahrung, dass nur Planung und gründliche Vorbereitung, die nichts dem Zufall überließen, zum Triumph führten.
Ohnehin waren Planung und Vorbereitung der Schlüssel zu jedem erfolgreichen Feldzug, ob es dabei um eine Allianz oder einen Krieg ging. Und da jeder wusste, dass ein falsch betontes Wort genügen konnte, um aus einem verbündeten Clan einen Kriegsgegner zu machen, hatte er die letzten Monate damit verbracht, sich auf diese Reihe von Begegnungen gründlich vorzubereiten.
Vor ihm ging das Gelände in eine Ebene über, aber die Bäume standen weiterhin so dicht, dass sie einen Großteil des Sonnenlichts abhielten und den Weg in tiefe Schatten tauchten. Als er die Stelle erreichte, an der sich der Strom gabelte und ein Flussarm in Richtung der immer noch weit entfernten Feste abzweigte, während der andere nach Osten floss, wusste Duncan, dass er sich allmählich dem Treffpunkt außerhalb des Dorfes näherte. Nach einer Weile kam die niedrige Steinbrücke in Sicht, und er ließ sein Pferd gemächlich und in aller Ruhe im Schritt gehen.
Wie es aussah, war er etwas früher als geplant eingetroffen, also ließ er das Pferd trinken, während er aus seinem Beutel einen Schlauch holte und einen tiefen Schluck Ale nahm. Er entdeckte eine kleine Lücke zwischen den dicht an dicht stehenden Bäumen, saß ab und führte das Tier dorthin, dann holte er den eingewickelten Käse und ein hartes Stück Brot heraus. Da Ranald dafür sorgen würde, dass er nicht hungern musste, genügte der mitgebrachte Proviant, um seinen Magen für die nächste Zeit zu besänftigen.
Einige Zeit verstrich, und Duncan wurde allmählich unruhig, was nicht zuletzt daran lag, dass von den anstehenden Gesprächen sehr viel abhing. Er ließ das Pferd auf der Lichtung angebunden zurück und ging zur Brücke, um nachzusehen, ob Ranald bereits in einiger Entfernung auszumachen war. Ohne die Brücke zu überqueren, suchte er die zum Dorf führende Straße ab und hoffte, den Mann dort irgendwo zu entdecken.
Niemand war zu sehen.
Es war nicht Ranalds Art, sich zu verspäten oder ein Treffen zu versäumen. Dennoch beschloss Duncan, dem Mann etwas mehr Zeit zu lassen, bevor er selbst zu seinen Leuten zurückkehrte. Schließlich konnte er nicht ohne deren Begleitung zur Festung der Robertsons weiterreiten. Im Schutz der Bäume ging er nahe der Brücke auf und ab und wartete ungeduldig. Die einzigen Geräusche, die zu hören waren, stammten von den Tieren im Wald – und von ihm selbst, da er in Abständen stehen blieb und unbeherrscht schnaubte.
Auch wenn ihm der Ruf vorauseilte, bei schwierigen Verhandlungen eine unerschöpfliche Geduld an den Tag zu legen, besaß Duncan in Wahrheit nur wenig von dieser Tugend. Und da die Zeit nur unerträglich langsam verstrich, wurde er umso deutlicher auf diese Tatsache gestoßen. Als dann auf einmal ein Schrei die Stille zerriss, wirkte der so unwirklich, dass Duncan einen Moment lang glaubte, er habe ihn sich nur eingebildet.
Er legte den Kopf schräg und lauschte aufmerksam auf weitere Geräusche. Lange musste er nicht warten, denn als er sich langsam im Kreis drehte, um die Umgebung zu mustern, folgte bereits ein zweiter Schrei. Er war zwar nicht so laut wie der erste, doch er genügte, um die Richtung zu bestimmen. Duncan überquerte die Brücke und bog vom Weg ab, ging zwischen den Bäumen hindurch und gelangte schließlich zur Rückseite eines kleinen Cottages. Während er um das Gebäude herumging, horchte er wachsam auf jeden Laut. Schließlich blieb er stehen und spähte um die Ecke, um zu sehen, was sich vor dem Cottage abspielte.
Da er nicht damit gerechnet hatte, zum Schwert greifen zu müssen, hatte er es bei seinem Pferd auf der Lichtung gelassen. Daher konnte er nur seinen Dolch ziehen. Der glich von seiner Größe her mehr einem kurzen Schwert denn einem Messer und hatte sich in vielen Auseinandersetzungen bewährt. Mit schnellen Schritten wechselte er von der Ecke des Bauwerks in den Schutz eines großen Baums, um herauszufinden, was hier nicht stimmte.
Dann sah er sie – eine Frau, die sich gegen einen deutlich größeren und stärkeren Mann zu wehren versuchte.
Duncan ließ sich einen Moment Zeit, um die Situation einzuschätzen. Rasch erkannte er, dass der Frau keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben drohte, ihr die Umarmung aber sichtlich missfiel. Durch ihre Gegenwehr löste sich ihr Kopftuch und flatterte zu Boden, sodass ihr volles braunes Haar zum Vorschein kam. Plötzlich fiel ihm auf, dass sie nicht mehr schrie, und als er die beiden genauer beobachtete, wurde eines deutlich: Die Frau versuchte sich zusammen mit dem Mann so zu drehen, dass dessen Blick auf den Weg gerichtet war, der aus dem Wald zum Cottage führte, nicht jedoch auf das Haus selbst.
Ein Geräusch ließ ihn auf das Fenster an der Seitenwand des Cottages aufmerksam werden, und dann sah er auf einmal einem kleinen Kind in die Augen. Ein Mädchen, das nicht älter als fünf Jahre sein konnte, schaute aus einem schmalen Fenster in seine Richtung. Das Kind hatte das blondeste Haar, das ihm je untergekommen war, und seine Augen sowie die zitternde Unterlippe verrieten, welch schreckliche Angst es hatte. Beruhigend lächelte er es an, darum bemüht, ihm die Angst zu nehmen; gleichzeitig legte er einen Finger an die Lippen, um dem Kind zu bedeuten, dass es keinen Laut von sich geben sollte.
Jetzt war ihm klar, warum die Frau den Mann von ihrem Cottage abzulenken versuchte: Sie wollte das Mädchen beschützen. Duncan straffte die Schultern und kam hinter dem Baum hervor, räusperte sich lautstark und wartete, dass der Wüstling von ihm Notiz nahm. Es dauerte nur einen Moment, dann hatte der Mann sich umgedreht, wobei er darauf achtete, dass sich die Frau zwischen ihm und dem Neuankömmling befand.
„Mir scheint, die Dame ist nicht an den Bekundungen Eurer Gunst interessiert“, sagte Duncan. „Lasst sie jetzt in Ruhe.“
Zwar blieb der Mann stehen, die Frau ließ er jedoch nicht los.
„Misch dich nicht in Angelegenheiten ein, die dich nichts angehen“, knurrte der Mann und zog die Frau ein paar Schritte hinter sich her, um den Abstand zu Duncan zu vergrößern.
Als er jetzt das Gesicht der Frau musterte, fiel ihm auf, dass sie weniger verängstigt als vielmehr verärgert zu sein schien. Ein gefasster, entschlossener Ausdruck prägte ihre Miene, auch wenn sie sich nicht so wie zuvor gegen den Griff zur Wehr setzte. Sie flüsterte etwas, das nur der andere Mann hören konnte – so als wolle sie ihn vor irgendetwas warnen.
„Lasst sie los und geht Eures Weges“, forderte Duncan ihn auf und hielt zusätzlich seinen Dolch vor sich ausgestreckt, um zu zeigen, dass er bewaffnet war.
Derartige Widrigkeiten konnte er jetzt überhaupt nicht gebrauchen, standen doch wichtige Verhandlungen bevor. Natürlich würde er nicht zögern, die Frau zu verteidigen, sollte es notwendig werden, doch zugleich forderte er damit die Frage heraus, was er auf fremdem Land zu suchen hatte, ohne dass der Laird von seiner Anwesenheit wusste. Duncan konnte nur hoffen, dass der Mann glaubte, er würde nicht zögern, seine Waffe einzusetzen, und dass er die Flucht ergriff. „Lasst die Frau los.“
Obwohl er den Eindruck machte, als wolle er nicht auf die Forderung reagieren, ließ der Mann schließlich doch die Arme sinken und stieß die Frau von sich weg. Ohne noch ein Wort zu erwidern, rannte er den schmalen Weg entlang und war im nächsten Moment im Wald verschwunden.
Duncan ging zügig auf die Frau zu, die das Gleichgewicht wiederfand, bevor er bei ihr war, um sie zu stützen. Sie hob das Tuch vom Boden auf, schüttelte es aus und legte es mit geschickten Bewegungen über ihr Haar, ehe sie sich zu Duncan umdrehte. Ihr Blick auf seinen Dolch ließ ihn erkennen, dass er seine Klinge immer noch einsatzbereit vor sich hielt. Er steckte die Waffe weg und musterte die Frau genauer, die da vor ihm stand.
Sie reichte ihm gerade einmal bis zur Schulter, und sie war jünger als angenommen. Es war ihre Kleidung, die sie zumindest auf den ersten Blick älter und auch etwas fülliger wirken ließ. Duncan hatte ihr beeindruckend langes braunes Haar gesehen, aber ihre Augen waren das eine Merkmal an ihr, das ihn ganz besonders faszinierte – zum einen wegen des hochintelligenten Blicks, den sie ihm zuwarf, zum anderen wegen ihrer Farbe, die er nicht anders beschreiben konnte als ein tiefes Eisblau.
Nur ihr Mund hatte auf ihn eine noch stärker ablenkende Wirkung, zumal sie in diesem Moment mit der Zungenspitze über ihre vollen blassroten Lippen fuhr.
„Ich danke Euch für Eure Hilfe, Sir. Er war mehr ein Ärgernis als eine Gefahr“, erklärte sie, ohne sich ihm zu nähern. Abermals fiel ihm auf, dass sie sich in eine Richtung bewegte, die ihn vom Cottage weglotste.
So wie jede gute Mutter versuchte sie, jegliche Gefahr für ihre Tochter auf sich selbst zu lenken.
„Euer Schrei hat aber etwas anderes besagt“, gab er zurück und wartete einen Moment lang auf ihre Antwort.
„Laren hat mich überrascht, weiter nichts.“ Mit einer Kopfbewegung deutete sie auf den Pfad, der in den Wald führte, dann musterte sie Duncan von Kopf bis Fuß. „Ihr seid nicht aus dem Dorf.“ Sie sah sich um und fragte schließlich: „Was führt Euch zu mir?“
„Ich bin ein Besucher“, erwiderte er ruhig. Es entsprach der Wahrheit, warum sollte er das also nicht sagen.
„Dann wollt Ihr aber sicherlich nicht mich besuchen, oder?“
Ihre Worte waren unmissverständlich abweisend, doch der Ausdruck in ihren Augen verriet ihm noch etwas anderes: Ihr wurde eben erst bewusst, dass sie womöglich in eine viel gefährlichere Situation geraten war, nachdem dieser Laren die Flucht ergriffen hatte. Jedoch verfolgte er keinerlei Absichten in dieser Richtung, sondern ihm war in erster Linie daran gelegen, von keinem Mitglied des Robertson-Clans gesehen zu werden, bevor er offiziell dessen Festung erreicht hatte.
„Und nun, da Ihr in Sicherheit seid, werde ich weiter meines Weges ziehen. Ihr könnt Euch wieder ganz Eurer Tochter widmen“, versicherte er ihr und wandte sich ab. Die Frau schnappte bei seinen Worten erschrocken nach Luft und eilte an ihm vorbei, um sich zwischen Duncan und das Cottage zu stellen. „Sie wartet drinnen auf Euch. Ich sah sie im Vorbeigehen am Fenster stehen“, erklärte er. „Bevor ich meine Reise fortsetze, werde ich mich nur noch davon überzeugen, dass dieser Laren tatsächlich fortgegangen ist.“
Er sah ihr nach, wie sie ins Cottage verschwand und die Tür hinter sich zuschlug. Dann hörte er, wie sie die Tür mit einem Riegel sicherte. Dem dumpfen Laut nach zu urteilen, musste er groß und schwer sein. Duncan suchte die Umgebung des Cottages ab, und erst als er keinen Hinweis darauf finden konnte, dass der Mann sich in der Nähe versteckt hielt, kehrte er zurück auf den Weg, der zur Brücke führte. Er überquerte den Fluss und ging zur Lichtung, um nach seinem Pferd zu sehen und sich zu vergewissern, dass seine Habseligkeiten noch vollständig vorhanden waren. Dann begab er sich wieder an den vereinbarten Platz, um auf Ranald zu warten.
Doch während er auf seinen Freund wartete, dachte er nicht über die Verhandlungen nach, die zu einem Bündnis führen sollten. Stattdessen kreisten seine Gedanken um diese Frau, die sich alle Mühe gegeben hatte, ihm ihr wahres Wesen zu verbergen.
Und er kannte nicht einmal ihren Namen.
Marian verfluchte sich, während sie zu Atem zu kommen versuchte. Allen Bemühungen zum Trotz, Ruhe zu bewahren, raste ihr Herz, und vor Angst schmerzte ihre Brust. Nicht Laren war der Grund für ihre Angst, stellte der Mann doch tatsächlich in erster Linie ein lästiges Ärgernis dar, sondern der Fremde, der plötzlich aufgetaucht war, um sie zu beschützen. Bevor sie sich aber weitere Gedanken über seine dunklen Augen und seine hochgewachsene Statur machen konnte, hörte sie eine leise Stimme nach ihr rufen.
„Mama!“, schrie ihre Tochter, rannte auf sie zu und schlang die Arme um die Beine ihrer Mutter. „Mama …“, wiederholte sie und begann zu schluchzen.
„Ciara, meine Süße“, besänftigte sie die Kleine und löste den Griff um ihre Beine, um ihre Tochter hochzunehmen und an sich zu drücken. „Es ist alles in Ordnung, mein Liebes“, flüsterte sie und strich ihr die blonden Strähnen aus dem Gesicht, dann setzte sie sich und ließ Ciara auf ihren Schoß klettern, um sie zu wiegen, bis sie aufhörte zu weinen.
Als sie von Laren bei der Arbeit im Garten überrascht worden war, hatte sie Ciara sofort ins Haus geschickt. Diesen Ablauf hatten sie immer wieder geübt, seit sie von dem fernen Anwesen ihres Vaters im Süden nach Dunalastair zurückgekehrt war. Getrennt von ihrer Familie zu leben, ohne den Schutz eines Ehemanns oder eines Vaters, konnte Gefahren für sie mit sich bringen, denen sie lieber aus dem Weg ging. Auch wenn die meisten noch gar nicht durchschaut hatten, wer sie eigentlich war, konnte es riskant sein, als Mutter allein mit einem Kind zu leben.
Ciara wusste, dass sie ins Cottage laufen und sich neben dem Schrank verstecken musste, wenn ihre Mutter sie dazu aufforderte. Marian hatte immer gebetet, so etwas möge nicht erforderlich werden, doch der heutige Tag zeigte ihr, dass sie ihrer Vergangenheit wahrscheinlich nicht entrinnen konnte. Ihre Tochter beruhigte sich, und Marian lockerte ihren Griff ein wenig. Sie küsste sie auf den Kopf und erklärte ihr im Flüsterton, wie stolz sie darauf war, dass Ciara ihre Anweisungen so brav befolgt hatte. Daher kam die Frage ihrer Tochter für sie umso überraschender. Eine Frage, die sie an etwas erinnerte, worüber sie nicht hatte nachdenken wollen – über den Fremden, der zu ihr geeilt war, um sie zu beschützen.
„Mama, wer war der Mann?“, wollte Ciara wissen, rieb sich die Augen und sah sie an. „Ist er weg?“
„Das war Laren, meine Süße, und ja, er ist weg. Ich glaube, er wird uns nicht wieder belästigen“, sagte sie, um das Kind zu beruhigen.
„Nicht der Mann, Mama. Der andere Mann. Der nette Mann, der gelächelt hat.“
Marian war einen Moment sprachlos. Ihr war gar nicht in den Sinn gekommen, dass dieser Mann nett sein oder gar lächeln könnte. Er hatte so ernst dreingeblickt und wütend, sein Gesicht war ihr wie versteinert erschienen, als könnte er seinen Mund nicht zu einem Lächeln oder auch nur zu einem freundlichen Ausdruck verziehen. Mit dem Dolch in der Hand war er ihr vielmehr wie jemand vorgekommen, der über sie herfallen würde, sobald er Laren weggeschickt hatte. Der Mann war noch größer als ihr ältester Bruder Iain, und seine Schultern waren breiter als die des Schmieds Ranald hier aus dem Dorf. Unwillkürlich lief ihr ein Schauer über den Rücken.
Ehrfurcht erregend war wohl zutreffender, wenn man ihn beschreiben wollte.
Selbst in dem Augenblick, in dem sie wusste, dass er ihre Angst wahrgenommen hatte, war bei ihr nicht das Gefühl aufgekommen, in Gefahr zu schweben. Seine bemerkenswerte Erscheinung wirkte überwältigend, ohne dass sie körperliche Gewalt von ihm befürchtete. Ihre Tochter hatte einfach nur einen jener fantasievollen Gedanken ausgesprochen, die kleinen Kindern hin und wieder durch den Kopf gingen.
„Den Mann kannte ich nicht“, flüsterte sie Ciara zu, die sich müde gegen sie sinken ließ.
Auch wenn ihre Tochter viel zu schnell groß wurde, war sie doch noch ein kleines Mädchen und verbrachte einen Teil des Tages mit Schlafen. Jetzt, da die Aufregung sich gelegt hatte, holte die Müdigkeit sie ein. Marian drückte Ciara an sich und summte leise ein Lied, damit sie leichter einschlief. Es dauerte nicht lange, da konnte sie aufstehen und die Kleine ins Bett bringen. Nachdem sie die Wolldecke über Ciara gelegt hatte, ging sie zur Haustür, hob den Riegel an und begab sich nach draußen, um sich davon zu überzeugen, dass sich niemand in der Nähe aufhielt.
Der spätsommerliche Wind wehte durch die Baumkronen und trug bereits eine leichte Kühle mit sich. Nur noch wenige Wochen, dann mussten die Viehtreiber entscheiden, welches Vieh von den Hügeln in die Täler getrieben und welches geschlachtet oder verkauft werden sollte. Marian betrachtete ihren eigenen kleinen Garten und wusste schon jetzt, dass viel Arbeit vor ihr lag, all die Kräuter zu pflücken und zu trocknen, die sie für den kommenden Winter gepflanzt hatte.
Während sie um ihr Cottage herumging, suchte sie nach Hinweisen auf mögliche Eindringlinge – und sie hielt Ausschau nach dem Fremden, der wie aus dem Nichts in ihr Leben getreten war und sich gleich wieder in Luft aufgelöst hatte. Alles schien in Ordnung zu sein, ihr Garten wirkte unversehrt, nirgendwo war etwas zertrampelt worden. Sie hob den Kopf und lauschte den Geräuschen aus dem Wald. Vögel flogen vorüber, der Wind ließ die Blätter rascheln, und Wolken zogen über den Himmel, ganz so, wie es an einem Tag im September auch sein sollte.
Wäre da nicht ihr rasendes Herz gewesen, hätte sogar sie diesen Tag für einen ganz gewöhnlichen Tag in Dunalastair gehalten. Marian versuchte, sich auf die Arbeiten zu konzentrieren, die sie noch erledigen musste, doch ihre Gedanken kehrten immer wieder zu diesem rätselhaften Fremden zurück.
Im Geiste sah sie nur seine Augen – so dunkel, dass sie fast schon schwarz waren –, die Laren wütend angefunkelt hatten und dann so eindringlich auf sie gerichtet gewesen waren, als er davon sprach, dass er ihre Tochter am Fenster gesehen hatte. Dieses Mienenspiel, zusammen mit seiner ausgeprägt männlichen Statur, machte es ihr jetzt so schwer zu atmen.
Noch nie hatte sie, die Robertson-Hure, einen Mann so faszinierend gefunden. Niemals war sie in den letzten fünf Jahren so unachtsam gewesen und hatte einen Mann derart auf sich wirken lassen wie diesen Fremden. Es war zu gefährlich, eine solche Nachlässigkeit überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, dass es ihr nie eingefallen wäre, sich dagegen wappnen zu müssen.
Sie hatte damit gerechnet, dass es zu Zwischenfällen wie dem mit Laren kommen würde, sobald sich herumsprach, wer sie war. Aber ihr Bruder würde für den Fall Befehle erteilen, die jeden davon abhalten sollten, sich ihr in einer ernsthaften Weise zu nähern.
Doch ihr war nie in den Sinn gekommen, dass die Gefahr von einem solchen Fremden ausgehen würde. Nach diesem Blick in seine unergründlichen dunklen Augen wusste sie, er war gefährlicher als jeder Mann vor und auch nach ihm. Es war die Erinnerung an seine Augen, die sie für den Rest des Tages verfolgte.
2. KAPITEL
Duncan ließ die Brücke nicht aus den Augen, während er und seine Männer darauf zuritten. Auf einmal spürte er, wie sich sein Magen verkrampfte. So erging es ihm immer, wenn neue Verhandlungen anstanden. Sein Magen war sein großer Schwachpunkt, aber sein Verstand war scharf wie eine Messerklinge und auf die vor ihm liegende Aufgabe konzentriert. Im Verlauf der zwei Tage, an denen er mit Ranald geredet hatte, waren keine Überraschungen ans Licht gekommen, die zu Problemen mit dem Laird führen könnten.
Vielmehr war ihm bestätigt worden, dass der Robertson-Clan genauso stark und gut geführt war wie in den ihm zuteilgewordenen Berichten dargestellt. Es hieß nun, wenn diese Allianz besiegelt war, würde der Laird sich eine neue Frau aus einem der nördlichen Clans nehmen, um die Position seines Clans als Schottlands Beschützer zu festigen. Einige bedenkliche Gerüchte kursierten immer noch über den neuen Laird, die bereits zu Lebzeiten seines Vaters in die Welt gesetzt worden waren, und Duncan wusste aus seiner eigenen Erfahrung als Laird, dass Gerüchte und Unterstellungen sehr schnell den Ruf eines Mannes ruinieren konnten. Daher war es ein guter Zug des Lairds, eine neue Ehe zu planen, nachdem seine erste Frau bei der Geburt ihres Kindes gestorben war.
Einer seiner Männer rief etwas, und Duncan richtete seinen Blick auf die Straße vor ihnen. Ein Trupp schwer bewaffneter Robertson-Krieger erwartete sie auf der anderen Seite der Brücke. Sofort setzte er sich gerader hin und straffte die Schultern, um dann seinen Leuten eine Warnung mit auf den Weg zu geben.
„Ihr habt eure Befehle, und ihr wisst, wie wichtig es ist, dass unsere Reise erfolgreich verläuft. Von jetzt an wendet ihr euch mit allen Beobachtungen und Fragen direkt an mich. Beruft euch auf nichts, was Connor gesagt hat.“
„Brauchen wir dann etwa auch deine Erlaubnis, wenn wir pinkeln gehen wollen, Duncan?“, rief Hamish ihm zu.
„Aye, Hamish, sogar das“, erwiderte er todernst. „Wichtiger ist aber, dass ihr die Finger vom Ale und von den Frauen lasst. Beides kann einen Mann mehr als alles andere in Schwierigkeiten bringen.“
Duncan fasste das Gemurmel seiner Männer als Zustimmung auf und trieb sein Pferd an, damit es sich wieder in Bewegung setzte. Er zog seinen Umhang, Tartan genannt, zurecht, dann führte er die MacLeries über die Brücke nach Dunalastair. Die Robertsons begrüßten sie förmlich und hießen sie willkommen, sie zum Eingang zur Festung zu begleiten, die noch ein Stück weit entfernt war. Duncan nickte und bedankte sich für die Einladung.
Erst als er auf dem Weg zur Festung in die Gesichter der Dorfbewohner schaute, die gekommen waren, um ihre Ankunft mitzuerleben, wurde ihm klar, dass er nach ihr Ausschau hielt.
Als er mit Ranald gesprochen hatte, war er stets darauf bedacht gewesen, seine wachsende Neugier im Zaum zu halten, damit er ihn nicht nach dieser Frau fragte. Auch hatte er die ganze Zeit in Ranalds Haus oder in dessen Schmiede verbracht, damit er nicht mit Nachbarn oder Dorfbewohnern zusammentraf, die ihn später wiedererkennen könnten. Dennoch war der Wunsch immer stärker geworden, mehr über diese Frau zu erfahren. Und deshalb schaute er jetzt genau in die Gesichter der Menschen.
Aber er entdeckte sie nirgends.
Im Stillen ermahnte er sich, weil es ihm nicht gelang, bei der Sache zu bleiben. Plötzlich bemerkte er, dass er langsamer geworden war, nur um sie nicht zu übersehen. Caelan, jener Mann aus dem Robertson-Clan, der sie an der Brücke in Empfang genommen hatte, drehte sich zu ihm um, weil er ihm offenbar etwas sagen wollte, doch sein Blick wanderte stattdessen zum Wegesrand, wo sich jemand im Schatten versteckt hielt. Als Duncan in die gleiche Richtung schaute, entdeckte er die Frau wieder, die sich mit dem Mädchen an der Hand von den anderen Dorfbewohnern weit genug entfernt aufhielt, um niemandem im Weg zu stehen. Trotzdem war sie nahe genug ans Geschehen herangekommen, um herausfinden zu können, aus welchem Grund die Robertson-Kämpen durch das Dorf ritten.
Das Mädchen klammerte sich an den Röcken der Mutter fest und verschwand fast ganz in den weiten Falten. Nur als die Kleine etwas zu ihr sagte, war ihr Kopf zu sehen. Die Frau beugte sich vor und antwortete, ohne den Blick von Caelan zu nehmen. Duncan schaute den jüngeren Bruder des Lairds an und bemerkte dessen Mienenspiel, was in ihm die Frage aufwarf, ob die Frau wohl Caelans Geliebte war. Nur einen Moment, nachdem Duncan sie wiedergefunden hatte, war sie auch schon wieder im Gewirr der Cottages untergetaucht, weggeschickt von Caelan, der dazu nur flüchtig hatte nicken müssen.
Ein auffälliges Räuspern, das von Hamish kam, erinnerte Duncan an die Anweisungen, die er seinen Leuten erteilt, selbst aber offenbar bereits wieder vergessen hatte. Die anderen schlossen sich dem Räuspern an und ließen ihn wissen, dass keinem von ihnen entgangen war, wie er sich vom Anblick dieser Frau in den Bann hatte schlagen lassen. Er zwang sich, seine Gedanken ausschließlich auf das zu richten, was ihn in der Festung erwartete. Beruhigt stellte er fest, dass er immer noch in der Lage war, sich die Zahl der Männer ins Gedächtnis zu rufen, die für den Clan in den Kampf ziehen würden. Er wusste auch noch, wie viele Stück Vieh die Robertsons besaßen und wie viele Zusammenkünfte und Gespräche ihm in den kommenden Wochen bevorstanden. Und später würde er sich rühmen, dass er auf dem Ritt zur Festung nur ein einziges Mal an die junge Mutter mit dem gequälten Blick und an ihr reizendes Mädchen gedacht hatte.
Die heilige Muttergottes möge ihr beistehen!
Marian hielt Ciaras Hand fest umklammert und rannte regelrecht zurück zu ihrem Cottage. Damit ihre Tochter nicht dagegen protestierte, machte sie daraus ein Spiel, sang ihr ein Lied vor und zählte mit ihr die Steine am Wegesrand. Ihre eigene Stimme hörte sich fremd an, und ihr Herz schlug so heftig, dass es fast jedes Geräusch ringsum zu übertönen schien.
Caelan! Caelan war hier!
Sie hatte ihn verwechselt, als er an der Stelle vorbeiritt, an der sie weit genug in die Schatten zurückgezogen gestanden hatte, um von niemandem bemerkt zu werden. Der Lärm, den die Krieger bei der Ankunft an der Brücke gemacht hatten, die Aufregung über die Neuigkeit, dass die MacLeries ins Dorf gekommen waren, und das Rätselraten, was sie hergeführt haben mochte, heizten die Gerüchte an, die von Cottage zu Cottage getragen wurden.
Besucher waren grundsätzlich interessant, doch dass ein Mann in ihr Dorf gekommen war, der große Macht besaß und den man – wenn auch hinter vorgehaltener Hand – immer noch als die Bestie der Highlands bezeichnete, das würde auf Wochen hinaus für Gesprächsstoff sorgen. Von Neugier angetrieben, war Marian den anderen Frauen ins Dorf gefolgt, die die Ankunft der Besucher mitverfolgen wollten.
Dort hatte sie fast der Schlag getroffen.
Der Mann, der die MacLerie-Krieger anführte, war der Fremde, der nur drei Tage zuvor Laren verscheucht hatte! Zugegeben, er war jetzt vornehmer gekleidet. Auf dem Plaid über seiner Schulter glänzte das Abzeichen seines Clans, dennoch hätte sie dieses Gesicht und diese Augen unter Tausenden wiedererkannt. Nun ritt er von acht Kriegern gefolgt durch Dunalastair. Auf sie war er bis dahin nicht aufmerksam geworden, deshalb zog sie sich zusammen mit Ciara noch ein Stück tiefer in die Schatten zurück.
Dann folgte der zweite Schlag, der ihr die Sprache raubte: Ihr jüngster Bruder Caelan war derjenige, der die Krieger zur Festung führte. Sie hatte davon gehört, dass er vor Kurzem zurückgekehrt war, doch bislang hatte sie ihn rund ums Dorf noch nicht zu Gesicht bekommen. Von ihrem Vater war er zu einem Cousin in der Nähe von Skye geschickt worden, damit der sich seiner annahm, gut drei Jahre vor … vor den Ereignissen, die sich vor fünf Jahren zugetragen hatten. Er musste jetzt wohl sechzehn sein und damit fast ein Mann. Offenbar genoss er Iains Vertrauen, wenn der Caelan die Ehre überließ, einen so hochrangigen Gast nach Dunalastair zu geleiten.
An ihrem Cottage angekommen, setzte sich Marian auf den Hocker, der in der Nähe des Gartens stand, um das geerntete Gemüse zu schrubben. Als Ciara auf einmal ihre feuchte Wange berührte und sie fragte, warum sie traurig sei, wurde Marian klar, dass sie von dem Moment an, da sie Caelan gesehen hatte, nicht länger ihre Tränen hatte zurückhalten können. Mit dem Handrücken wischte sie sich übers Gesicht, dann atmete sie einmal tief durch, bevor sie auch nur versuchte, etwas zu sagen.
„Ich bin nicht traurig, meine Süße“, gab sie zurück und zwang sich dazu, ein Lächeln aufzusetzen. „Ich bin nur aufgeregt, weil so viele Fremde mit ihren Pferden im Dorf sind und weil sich alle versammelt haben, um sie zu sehen.“
„Hast du das große schwarze Pferd gesehen?“, wollte Ciara wissen. „So ein großes Pferd habe ich noch nie gesehen!“
Marian musste über die Worte ihrer Tochter lachen. Ciara liebte Pferde, und auch wenn sie hier – anders als auf dem Anwesen ihres Vaters – über keines dieser edlen Reittiere mehr verfügte, hatte sie doch mithilfe von Geschichten diese Begeisterung für Pferde an ihre Tochter weitergeben können.
„Das war wohl das größte Pferd von allen“, stimmte Marian ihr zu und wischte die letzten Tränen fort. „Ich dachte, deine Lieblingsfarbe ist Braun.“
„Ja, braun“, bestätigte sie. Ihre Augen strahlten, so wie immer, wenn sie über etwas redete, das sie begeisterte. „Aber ich glaube, Schwarz finde ich jetzt schöner.“
Marian hielt inne, da ihr einfiel, dass nur ein Reiter auf einem schwarzen Pferd gesessen hatte, nämlich er. Der Mann von den MacLeries. Zwar wusste sie jetzt, zu welchem Clan er gehörte, aber seinen Namen kannte sie nach wie vor nicht.
Unterdessen begann Ciara wie ein Wasserfall über Pferde im Allgemeinen und über dieses Pferd im Besonderen zu reden. Marian nahm ihre Schaufel und machte dort weiter, wo sie aufgehört hatte, als sie losgelaufen war, um die Reiter beim Überqueren der Brücke zu beobachten. Sie grub wieder die Erde um, weil sie sich in ihrer Arbeit verlieren und nicht über den Mann auf dem schwarzen Pferd nachdenken wollte, der ihr womöglich nur Schwierigkeiten einbringen würde.
Duncan nahm die Satteltasche mit Pergamentrollen, Karten und Blättern und suchte nach einer Schriftrolle, ehe er sich umdrehte und Caelan folgte, der ihn in die Festung zum Laird bringen sollte. Er gab die Ledertasche an Hamish weiter, damit der sie trug. Dann begaben sie sich nach drinnen und gingen die Steintreppe hinauf in das erste Stockwerk, wo sie in einen Korridor gelangten, der zu einem großen Saal führte. Die Männer, die dort auf ihre Ankunft warteten, liefen in diesem Raum auf und ab, der nur halb so groß war wie der entsprechende Saal auf Lairig Dubh.
Es war ein sauberer Saal, an dessen Wänden Teppiche hingen, auf denen Volkssagen und Mythen ihres Landes dargestellt waren. An einer Seite fand sich ein ausladender Kamin, gleich daneben ein Podest mit einer langen Tafel. Am Kopfende der Tafel stand auf der obersten Stufe ein wuchtiger, mit kunstvollen Schnitzereien und Symbolen verzierter Stuhl. Iain the Bold saß dort, der Sohn von Stout Duncan und nun zweiter Chief des Clans Donnachaidh oder Robertson, wie er mittlerweile lieber genannt wurde.
Um ihn herum standen die drei anderen Söhne von Stout Duncan, die ebenfalls überlebt hatten – Padruig, Graem und Caelan, der sich soeben zu ihm gestellt hatte –, sowie andere Älteste und Berater des Clans. Mit Hamish an seiner Seite begab sich Duncan mit zügigen Schritten zum Laird, während der Rest seiner Männer ihnen folgte. Alle Gespräche verstummten, als sie sich dem Podest näherten.
„Ich grüße Euch, Mylord“, begann er und beschrieb eine tiefe Verbeugung. „Ich überbringe Grüße und eine persönliche Nachricht vom MacLerie.“ Er trat noch einen Schritt vor und präsentierte dem Laird eine Schriftrolle.
Der Robertson-Laird erhob sich und kam die Stufen vom Podest herunter, anstatt ihn zu sich zu winken. Dann schob er die Schriftrolle in sein Hemd und streckte die Hand zum Gruß aus. „Willkommen in der Festung Dunalastair, Duncan.“ Mit kraftvollem, festem Griff fasste er sein Gegenüber am Arm. „Ich biete Euch und Euren Männern die Gastfreundschaft meines Heims und Herds an, während wir über die Zukunft der Allianz zwischen den Robertsons und den MacLeries reden.“
Beifall und Rufe wurden bei diesen Worten im ganzen Saal laut, und Duncan nahm sich einen Moment lang Zeit, um seinen Gastgeber zu mustern. Die Berichte, die ihm zuteilgeworden waren, beschrieben sehr zutreffend den Mann, der dort vor ihm stand. Der Laird war groß, fast so groß wie er selbst, und er war jung, hatte er doch mit nur fünfundzwanzig Jahren von seinem Vater den Platz an der Spitze des Clans übernommen. Aber er war auch ein beliebter Laird, der sich auf den Rückhalt durch seine Leute verlassen konnte. Duncan konnte keinem der Männer an der Seite des Lairds anmerken, dass der dessen Meinung nicht teilte, und auch das entsprach dem Bild, das seine Nachforschungen ergeben hatten.
Ein Diener kam mit einem Krug voll Ale zu ihnen, den er auch Duncans Männern anbot. Der junge Robertson stieg wieder die Stufen hinauf auf das Podest, um von allen im Saal gesehen zu werden, dann hob er seinen Becher. Duncan wartete ab und bereitete in Gedanken seine Erwiderung vor.
„Ich heiße Euch willkommen, Duncan MacLerie, und ich möchte Euch bitten, Euch in meinem Saal, meiner Festung und meinem Dorf wie zu Hause zu fühlen. Euch und Euren Männern steht es frei, Euch inmitten der Robertsons nach eigenem Gutdünken zu bewegen, während wir Gespräche führen, die uns sicher zu Verbündeten und Freunden machen werden.“
Duncan lächelte und schaute beiläufig Hamish an. Beruhigt stellte er fest, dass dessen Miene keinen Argwohn erkennen ließ. Das war ein gutes Zeichen, denn Hamish besaß die Instinkte eines Fuchses und spürte jeden Hinweis auf Arglist und Verlogenheit sofort auf. Der Laird kam wieder die Stufen herunter, beugte sich vor und sprach Duncan ins Ohr, damit der ihn trotz des Jubels verstehen konnte.
„Euer Ruf ist hier bestens bekannt. Man nennt Euch Duncan den Friedensstifter, da Ihr schon so oft Krieg und Konflikt zwischen zerstrittenen Gruppen, Clans und sogar zwischen Ländern abwenden konntet. Ich fühle mich geehrt, in dieser Angelegenheit auf Eure Beteiligung zählen zu können.“
Die Erklärung kam unerwartet. Duncan nickte und nahm das Kompliment an, ohne es sich zu Kopf steigen zu lassen. Denn er wusste, welche Strategie dahintersteckte. Als der Jubel abebbte, hob Duncan seinen Becher und ließ seine Männer dem Beispiel folgen.
„Im Namen von Connor MacLerie, des Earl of Douran und Chiefs des Clans MacLerie, danke ich Euch für Eure Gastfreundschaft und gebe Euch mein Versprechen, dass ich alles daransetzen werde, unsere Clans in Freundschaft und Allianz zu verbinden.“ Er hielt seinen Becher noch höher und rief: „Auf Robertson! Auf Robertson!“ Seine Männer stimmten mit ein, ebenso die anderen Anwesenden im Saal, und erneut brandete lang anhaltender Jubel auf.
Der Laird lächelte ihn an und trank aus seinem Becher, dann gab er Duncan und dessen Begleitern ein Zeichen, ihm auf das Podest zu folgen. Auf der langen Tafel hatte man die verschiedensten Speisen angerichtet, auf großen Tellern lagen Brot, mehrere Käsesorten, Früchte und gekochtes Fleisch zur Auswahl. Der Laird bedeutete ihnen, Platz zu nehmen. Nachdem sie sich gesetzt hatten, schwirrten Diener um den Tisch herum, um Becher zu füllen, Essen zu servieren und jedem Wunsch der Gäste nachzukommen.
„Hattet Ihr eine angenehme Reise, Duncan?“
„Aye, Mylord“, erwiderte er und brach ein Stück Brot ab. „Das Wetter hat sich gehalten, und wenn wir Wind brauchten, wehte er kräftig aus der richtigen Richtung.“
„Seid Ihr direkt von Lairig Dubh hergekommen?“
Die Frage kam im Plauderton über die Lippen des Lairds, dennoch verbarg sich mehr dahinter. Schließlich wollten die Robertsons wissen, mit wem er noch verhandelte und wer demzufolge ihre Konkurrenten waren. Die Wahrheit zu sagen, war die einfachste Lösung.
„Nein, Mylord. Wir sind im Auftrag des Earls zuvor in Glasgow und Edinburgh gewesen, ehe wir in nördlicher Richtung nach Dunalastair aufgebrochen sind.“ Duncan bemerkte Hamishs Blick, als er einen Schluck Ale trank.
„Dann seid Ihr bereits unterwegs seit …?“
„Seit Mitte des Sommers, Mylord.“
„Wir sind Freunde, oder besser gesagt: Wir werden bald Freunde sein, also nennt mich doch Iain, so wie es mein Clan macht“, bot der Laird ihm an.
Offenbar hatte er die Prüfung bestanden, der er soeben unterzogen worden war, da der Laird einigen seiner Berater zunickte.
„Wenn Ihr das wünscht, Iain“, gab er zurück.
„Ich möchte Euch mit meinen Brüdern bekannt machen, den Söhnen von Duncan the Stout. Ihn habt Ihr bereits kennengelernt …“, er klopfte dem Mann neben ihm auf die Schulter, „… er ist mein jüngster Bruder Caelan.“ Duncan nickte, während Iain fortfuhr: „Er ist erst vor Kurzem von den MacLeans zurückgekehrt, die für eine Weile seine Pflegeeltern waren.“
Duncan hatte verstanden. Es bestand also eine gute Beziehung zum mächtigen Clan der MacLeans von den Inseln.
Er musterte Caelan und erkannte, dass der viel zu jung war, um der Ehemann oder Liebhaber der Frau zu sein, der er begegnet war … außerdem war er gar nicht zugegen gewesen, als das Kind gezeugt wurde, wenn Duncan richtig rechnete. Das Mädchen war ungefähr fünf Jahre alt und konnte deshalb nicht von ihm sein. Warum ihm das so wichtig war, wusste er selbst nicht zu sagen. Duncan wandte sich dem Mann daneben zu, der ihm vom Laird als Nächster vorgestellt wurde.
„Dies ist mein Bruder Padruig mit seiner Verlobten, Iseabail von den MacKendimens.“
Die MacKendimens waren ein kleiner, aber nicht unbedeutender Clan aus der Nähe von Dalmally, nicht weit von Lairig Dubh entfernt. Auch diese Verbindung entging Duncan nicht. Duncan the Stout wäre stolz darauf gewesen, wie Iain diese Machtdemonstration handhabte, ohne auch nur eine einzige Waffe in die Hand zu nehmen. Mit einem kurzen Nicken in Richtung der beiden wartete Duncan darauf, dass ihm auch noch der letzte Bruder vorgestellt wurde.
„Und das ist Graem“, begann Iain und deutete auf den Mann, der Hamish gegenübersaß. „Er hat vom Bischof von Dunkeld das Angebot erhalten, unter dessen Aufsicht sein Studium zu beginnen.“
Damit hatte er seine letzte Karte ausgespielt – den Kontakt zu einem der mächtigsten und bedeutendsten Bischöfe Schottlands, durch den der Clan eine enge Beziehung zur Kirche einging. Die Söhne von Duncan the Stout waren alle mit wichtigen Clans unterschiedlicher Größe in ganz Schottland verbunden, zudem war der Clan selbst eine der ältesten Familien des Landes und konnte seine Herkunft bis zu den keltischen Lords von Atholl zurückverfolgen. Welche Position der Clan heute einnahm, war auf Iains Weise eindrucksvoller demonstriert worden, als es mit der Nennung aller Vorfahren jemals möglich gewesen wäre. Duncan bewunderte den Laird dafür, dass er mit einer solchen Leichtigkeit klargemacht hatte, welche Stellung die Robertsons einnahmen.
Iain war zwar erst seit etwas mehr als zwei Jahren der neue Laird, aber er hatte den Clan fest im Griff, und er wusste, was er wollte. Danach zu urteilen, wie die anderen an der Tafel ihn ansahen, waren sie alle stolz auf ihn und würden seine Bemühungen ebenso unterstützen wie seine Entscheidungen.
Duncan erkannte, dass mit dieser Vorstellung von Iains Brüdern zugleich eine Herausforderung ausgesprochen worden war, und er spürte, wie das Blut in seinen Adern in Wallung geriet, da er sich auf einen guten Kampf freute. Nichts war ihm lieber als ein würdiger Widersacher am Verhandlungstisch, und nun wusste er, dass in den kommenden Wochen all sein Geschick gefordert sein würde.
„Wir beginnen morgen früh, wenn es Euch recht ist, Duncan“, sagte Iain.
„Aye, damit bin ich einverstanden.“ Duncan wollte sich so bald wie möglich ins Kampfgetümmel stürzen.
„Mein Steward wird sich darum kümmern, dass es Euch an nichts mangelt“, fuhr er fort, woraufhin ein älterer Mann vortrat und sich zum Laird stellte. „Wenn Ihr etwas benötigt, wendet Euch einfach an Struan.“
Struan verbeugte sich, und nachdem er sie nach ihren Wünschen in Bezug auf die Quartiere befragt hatte, zog er sich zurück, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen.
Das Essen verlief durchaus angenehm, auch wenn Duncan nach einer Weile feststellte, dass er keine Notiz davon nahm, was er aß oder trank. Er benötigte Zeit, um sich noch einmal gründlich mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und den Einzelheiten ihres Angebots zu beschäftigen, bevor die Nacht anbrach. Von Ungeduld erfüllt, musste er erkennen, dass er es kaum erwarten konnte, endlich mit den Verhandlungen zu beginnen.
Später würde Duncan auf seinen unangemessenen Eifer und seine Begeisterung zurückblicken und darüber lachen. Fünf Tage später, als sie in eine hitzige Diskussion vertieft waren, verlor Duncan der Friedensstifter zum ersten Mal überhaupt die Geduld.
3. KAPITEL
Das kann doch nicht Euer Ernst sein!“, brüllte Duncan und schlug so fest mit den Fäusten auf den Tisch, dass Dokumente und Schriftrolle durcheinandergewirbelt wurden. „Mit diesem Punkt habt Ihr Euch vor fast zwei Tagen bereits einverstanden erklärt!“
Er konnte spüren, wie ihm die Beherrschung entglitt, aber es gelang ihm nicht, sich zusammenzunehmen. Nie zuvor hatte er das Gefühl gehabt, dass der Boden unter seinen Füßen gleichsam mit einer dicken Schicht Öl überzogen war und er keinen Halt mehr finden konnte. Hamish warf ihm einen finsteren Blick zu, und das nicht zum ersten Mal. Auch der Unterhändler der Robertsons reagierte so, und selbst der Laird, der die meiste Zeit über stumm dabeistand und die Gespräche lediglich beobachtete, zeigte Missfallen über Duncans Tonfall. Dabei war Duncan nicht einmal klar, was bei ihm diese Wut hervorgerufen hatte.
„Ich war der Ansicht, Sir, dass alle Punkte weiterhin verhandelbar sind, bis der Laird den endgültigen Vertrag unterzeichnet hat. Ist das nicht länger die Art, wie wir vorgehen?“, fragte Symon und wandte sich einmal mehr zu Iain um, damit der diesen Worten zustimmte.
Duncan lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, atmete tief durch und rückte die Dokumente zurecht. Es war besser, diesem Symon eine Weile aus dem Weg zu gehen, da er fürchtete, sonst vollends die Beherrschung zu verlieren. Dann würden seine Fäuste statt auf dem Tisch im Gesicht seines Gegenübers landen. Er schob seinen Stuhl nach hinten, stand auf, verbeugte sich vor Iain und ging zur Tür.
„Das Wetter hat sich gebessert, und ich glaube, eine kurze Pause wird mir helfen, einen klaren Kopf zu bekommen. Wenn Ihr erlaubt, Iain?“
Ohne dessen Einverständnis abzuwarten, zog Duncan die Tür auf, ging den Korridor entlang und die Treppe hinunter, um zu den Ställen zu gelangen. Er hatte die Wahrheit gesagt, denn die letzten vier Tage hatte es unablässig geregnet, begleitet von Stürmen und Gewittern. Die Blitze hatten den Himmel zerrissen, die Donnerschläge ganz Dunalastair erzittern lassen. Aber an diesem Morgen fand sich keine Wolke am Himmel, und man hätte meinen können, dass sie alle sich das Unwetter nur eingebildet hatten. Vielleicht war das ja auch der Fall gewesen …
Im Stall angekommen begrüßte ihn sein Pferd mit dem gleichen Schnauben und Trampeln, das er selbst eben erst im übertragenen Sinne Symon gegenüber gezeigt hatte. Für Duncan war damit klar, dass sie beide etwas gegen die gereizte Anspannung unternehmen mussten, die sich in ihnen angestaut hatte. Binnen kürzester Zeit war sein Pferd bereit, und dann ritten sie durch das Tor der Festung hinaus und weiter durchs Dorf. Nach dem Überqueren der Steinbrücke überließ er es für eine Weile seinem Pferd, wohin es galoppieren wollte. Schließlich setzte Duncan Muskelpartien ein, die er schon zu lange nicht mehr benutzt hatte, und brachte das Tier wieder unter seine Kontrolle. Die Anstrengung wirkte belebend auf seinen Geist und Körper, und er lachte ausgelassen. Wenig später machte er kehrt, um wieder zur Feste zurückzureiten.
Unterwegs ließ er sich wieder und wieder das an diesem Morgen in Angriff genommene Werk durch den Kopf gehen, während er nach dem Grund für das plötzliche Problem suchte. Sie hatten bemerkenswerte Fortschritte gemacht, doch dann auf einmal war es ihm vorgekommen, als wären sie gegen eine massive Mauer gelaufen. Über jedes Wort und jedes Zugeständnis war plötzlich beharrlich diskutiert worden, aber auch wenn er noch so lange darüber nachdachte, wollte sich ihm nicht erschließen, wieso mit einem Mal alles ins Stocken geraten war. Also widmete er sich erneut den Stärken und Schwächen seines Angebots.
Als er das nächste Mal einen Blick auf seine Umgebung warf, befand er sich auf dem Weg, der zum Cottage der Frau führte, ohne dass er eine Erklärung dafür hatte, wie er dorthin geraten war.
Er wusste, er sollte umkehren und sich seinen Pflichten widmen, die in der Festung auf ihn warteten.
Er wusste, er sollte einen Bogen um diese Frau machen, denn sie würde ihn nur von seiner Aufgabe ablenken.
Für ihn hatte sie nichts Bemerkenswertes an sich, und dennoch zog ihn etwas zu ihr, damit er mehr über sie in Erfahrung bringen konnte.
Duncan schüttelte den Kopf über diese unsinnigen Gedanken. Er musste erschöpfter sein, als er zugeben wollte, wenn er sich so leicht aus seiner Konzentration bringen ließ. Vielleicht würde sie ihn ja nicht mehr so sehr interessieren, wenn er ihren Namen kannte. Vielleicht war es das Mysteriöse an ihr, das sie so anziehend machte. Fast hatte er sich schon dazu überreden können, doch weiterzureiten, ohne mit ihr gesprochen zu haben, da ging die Tür des Cottages auf und die Frau trat ins Freie.
Abermals faszinierte ihn, wie unterschiedlich sie aus der Ferne und aus der Nähe betrachtet aussah. Augenblicke später kam ihre Tochter nach draußen und folgte im Schatten ihrer Mutter, die ein kleines Gittertor öffnete und einen Garten gleich neben dem Gebäude betrat. Das sanfte, helle Gelächter der beiden wehte zu der Stelle, an der er auf seinem Pferd sitzend im Schatten der Baumlinie verharrte und sie beobachtete.
Er hatte mitangesehen, wie Connors Frau Jocelyn mit ihrem Sohn und in jüngerer Zeit mit ihrer Tochter auf diese Weise spielte, und bei diesen Gelegenheiten war mit ihm das Gleiche geschehen, wie es auch jetzt der Fall war: Eine Faust schien sich um sein Herz zu legen und es zusammenzudrücken. Mit jedem sanften Lachen und jedem liebevollen Wort wurde der Griff um sein Herz noch fester, und ihn überkam eine Sehnsucht, die so stark war, dass ihm der Atem stockte.
Sein Pferd musste seine Anspannung bemerkt haben, da es plötzlich unruhig wurde und auf der Stelle trat. Als er an den Zügeln ziehen wollte, um es zu besänftigen, glitt ihm einer aus der Hand. Stumm verfluchte er sein Ungeschick, saß ab und griff nach den Zügeln. Gerade wollte er wieder aufsitzen, da bemerkte er verwundert, wie still es geworden war. Er sah zum Garten, konnte aber Mutter und Tochter nirgends entdecken. Ob sie ihn wohl gesehen hatten und zurück ins Haus gegangen waren?
Es stand ihm nicht zu, die Frau anzusprechen, also beschloss er, sich zurückzuziehen. Er wollte sich wieder auf den Weg zurück zur Festung machen, doch in diesem Moment sah er das kleine blonde Mädchen, das den Kopf über die Steinmauer reckte, die rings um den Garten lief. Unwillkürlich musste er lächeln, dann verschwand die Kleine, ein leises Tuscheln war zu hören, und plötzlich tauchte der Kopf wieder auf. Zum Teufel mit meinen Absichten, dachte er.
„Guten Tag“, rief er, während er sein Pferd zum Weg führte.
Schweigen schlug ihm entgegen, und auch wenn er eigentlich keinen weiteren Versuch unternehmen wollte, konnte er sich dennoch nicht zurückhalten. „Guten Tag“, rief er abermals.
„Guten Tag, Mylord“, erwiderte die Frau, als sie sich aus ihrer gebückten Haltung erhob und sich ans Gartentor stellte.
„Sagt Duncan zu mir, nicht Mylord“, bat er sie kopfschüttelnd.