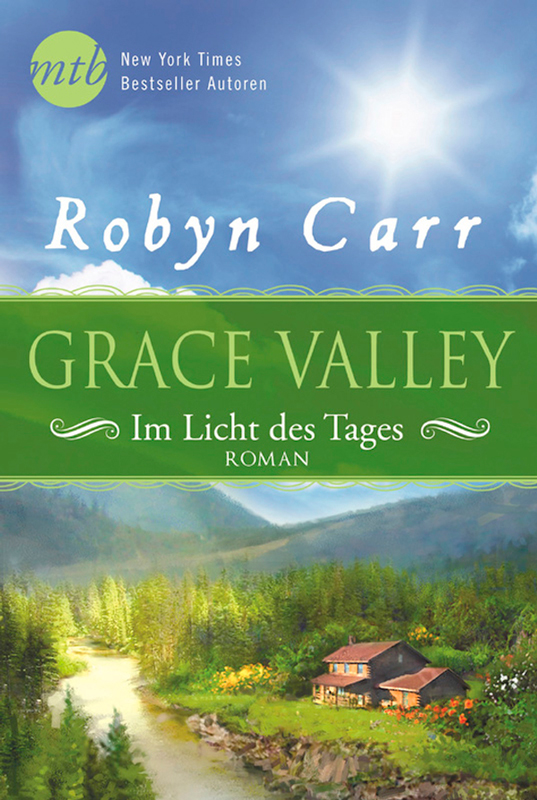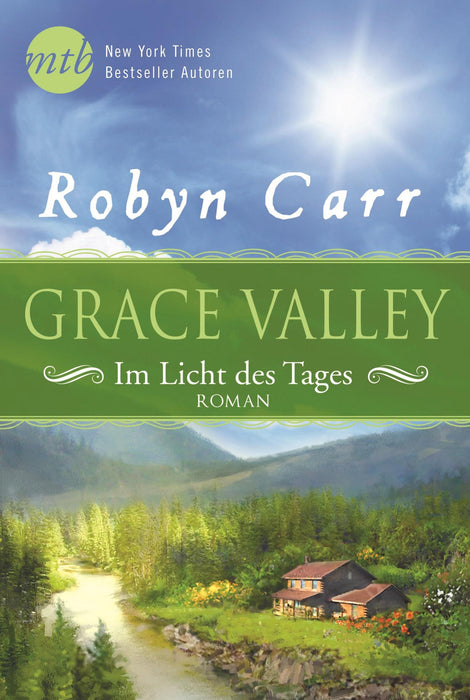
Grace Valley - Im Licht des Tages
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Willkommen zurück in Grace Valley, wo jeder für den anderen da ist!
In dem kleinen Ort Grace Valley ist es nahezu unmöglich, ein Geheimnis zu wahren - doch Dr. June Hudson ist es gelungen. Noch ahnt niemand etwas von ihrer Beziehung mit dem gut aussehenden Jim Post. Deshalb freuen sich auch alle, dass Junes Jugendliebe zurückkehrt - denn nichts wünschen sich die Bewohner des Tals mehr, als dass ihre Ärztin endlich den Mann fürs Leben findet. June weiß die warmherzige Fürsorge der Talbewohner zu schätzen, aber auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden, ist auch ein wenig anstrengend. Doch zum Glück haben auch noch andere Bewohner Geheimnisse, die die Dorfgemeinschaft in Atem halten. Bald geht es in Grace Valley drunter und drüber …