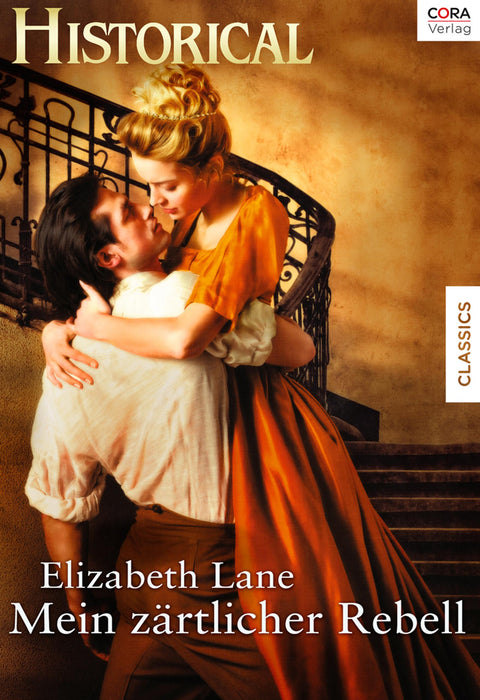
Mein zärtlicher Rebell
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Als die junge Mary 1899 ins ferne Afrika reist, will sie ihren Mann Cameron, der sie vor vier Jahren verließ, um die Scheidung bitten. Aber dann schlägt das Schicksal in der glühenden Wüste erbarmungslos zu: Ihre kleine Tochter wird entführt! Und plötzlich ist Cameron wieder an ihrer Seite - und ihr so nahe wie einst ...











