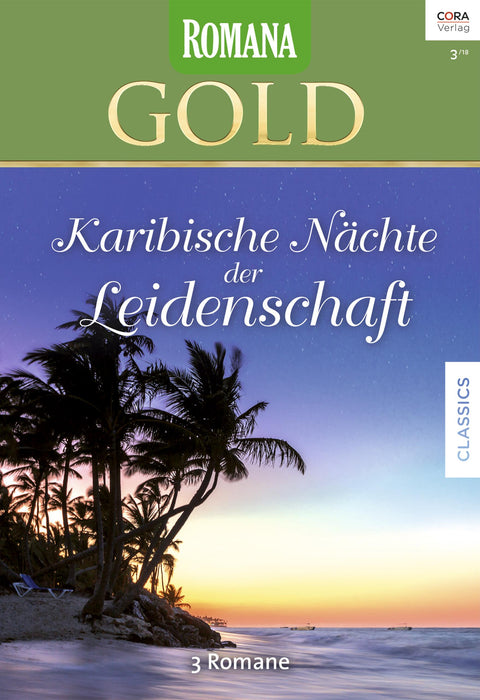
Romana Gold Band 45
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
UNSERE INSEL IN DER KARIBIK von ROSZEL, RENEE
Am endlosen Strand seiner Trauminsel findet Sam Taylor eine spärlich bekleidete Frau - so schön, als hätte die Karibik eine Nixe an Land gespült! Wer ist sie? Woher kommt sie? Sie verzaubert Sam völlig, aber verrät ihm nichts. Kann er das süße Geheimnis lüften?
EIN KARIBISCHES MÄRCHEN von GREIG, CHRISTINE
Auf einer Kreuzfahrt in der traumhaften Karibik möchte der reiche Manager Ryan Daniels die widerspenstige Laura verführen. Hier könnte er sie auch vor der Gefahr schützen, in der sie sich befindet, und ihr endlich seine Gefühle gestehen. Wenn sie es zulässt …
NUR EINE NACHT DER LIEBE? von MATHER, ANNE
Olivia hätte sich in dieser Nacht niemals auf Christian einlassen dürfen. Doch sie suchte Nähe - und er wärmte sie mit seinem Feuer. Jetzt ist Olivia schwanger; von einem beinahe Fremden, an den sie ihr Herz verloren hat. Und dennoch darf er ihr Geheimnis nicht erfahren.













