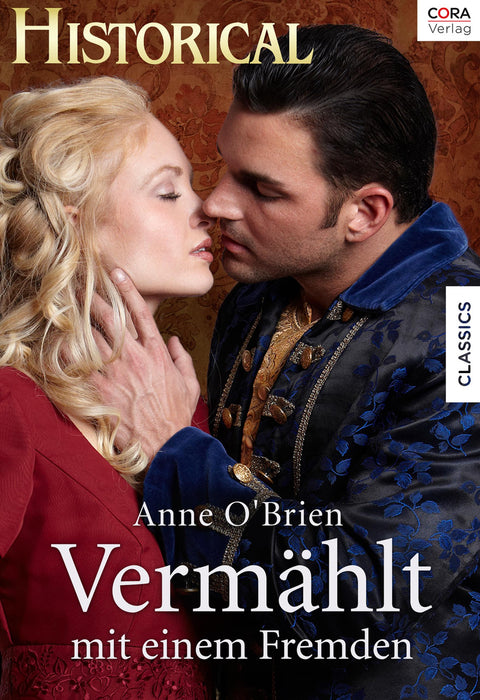
Vermählt mit einem Fremden
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Miss Harriette Lydyard pflegt eine gewagte Familientradition: Schmuggeln! Doch eines Tages beschert ihr die See mehr als verbotenes Strandgut: Sie rettet einen ohnmächtigen, höchst attraktiven Fremden. Wachend verbringt sie die Nacht an seinem Bett - und schon ist ihr Schicksal entschieden! Denn ihr Bruder drängt auf Heirat











