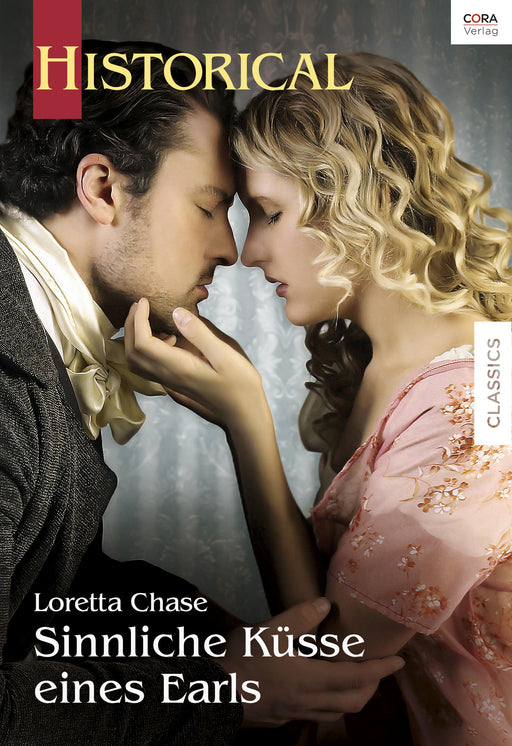Skandal in Samt und Seide
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Marcelline Noirot will nur eins sein: Londons erfolgreichste Damenschneiderin. Deshalb muss sie um jeden Preis den Auftrag für das Brautkleid der künftigen Duchess of Cleveland erhalten! Allerdings muss sie dafür zuerst deren Bräutigam für sich und ihre Kunst begeistern. Ein gewagter Plan, denn der Duke of Cleveland stellt sich als geradezu unwiderstehlich attraktiv heraus. Zwar versucht Marcelline nach Kräften, die knisternde Leidenschaft zwischen ihnen zu ignorieren. Doch ehe sie sich versieht, steckt sie mitten in einem skandalösen Spiel aus Gefahr und Verführung. Und plötzlich hängt ihre Zukunft am seidenen Faden …