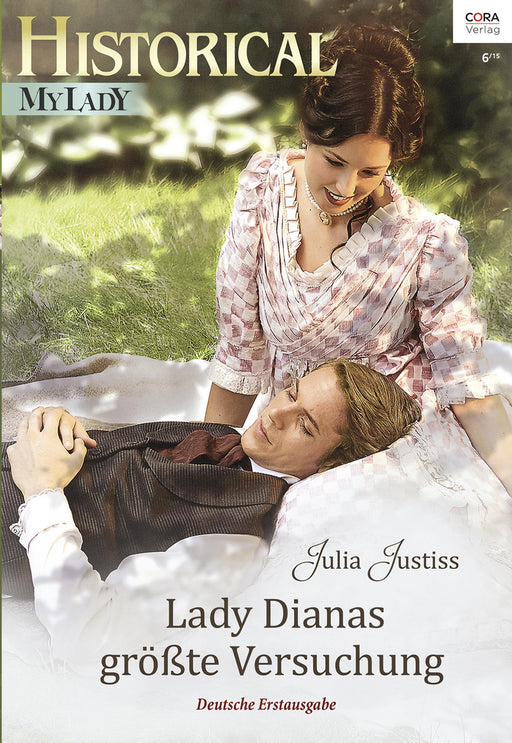Zwei Herzen im Frühling
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Durchtanzte Bälle, feurige Pferde, wilde Jagden: Von diesen Vergnügungen hat sich Captain Dominic Ransleigh nach einem Schicksalsschlag abgewandt. Bis die bezaubernde Theodora Branwall in sein zurückgezogenes Leben tritt. Temperamentvoll zeigt sie ihm, dass es immer einen Grund zum Tanzen gibt! Und ebenso für Zärtlichkeit und Küsse voller Leidenschaft …. Doch dann der Schock: Theodora reist nach London - um sich dort einen Ehemann zu suchen! Dominic eilt ihr hinterher, entschlossen, sie zur Frau zu nehmen. Wenn es dafür nicht schon zu spät ist …