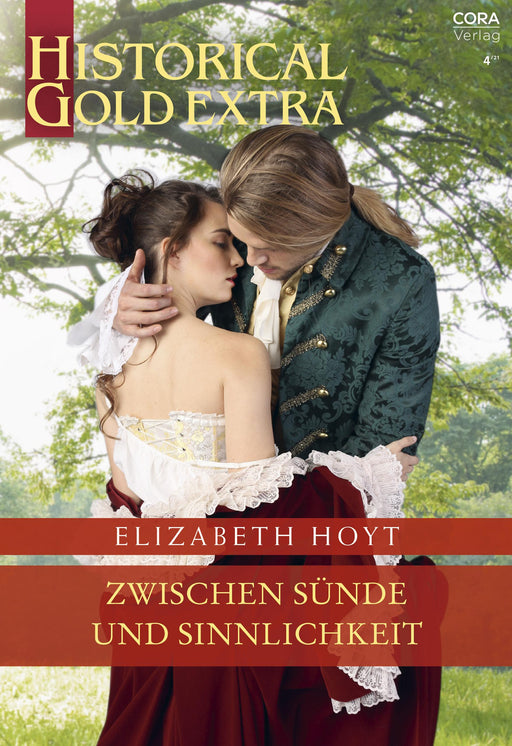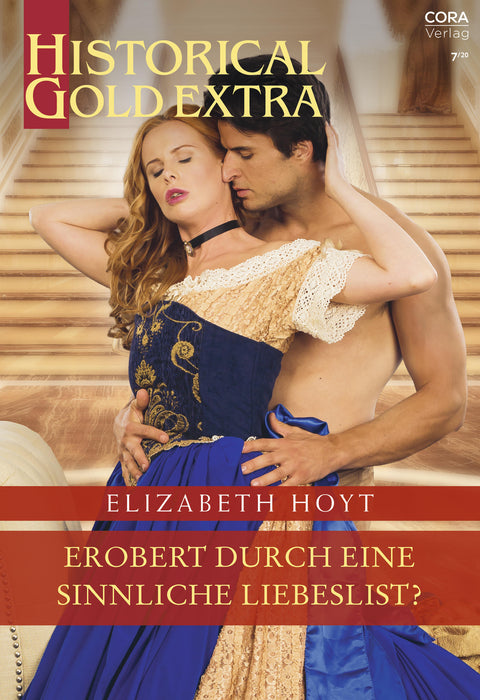
Erobert durch eine sinnliche Liebeslist?
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Lady Phoebe Batten ist jung, bezaubernd - und mit einem grausamen Schicksal geschlagen: Sie ist blind. Weder Ball noch Tanz gibt es für sie. Dass ihr besorgter Bruder auf einem Leibwächter besteht und den höchst einsilbigen Captain James Trevillion einstellt, ist für die lebenslustige Schönheit ein ständiges Ärgernis. Doch als auf sie ein mysteriöser Entführungsversuch verübt wird, rettet der Captain sie. Plötzlich nimmt Phoebe seine männliche Nähe erregend anders wahr! Verwegen beschließt sie: Auch wenn sie blind ist, hat sie Hände, Arme und einen süßen Mund, um James zu verführen. Aber noch immer lauern ihre Feinde im Dunkeln …