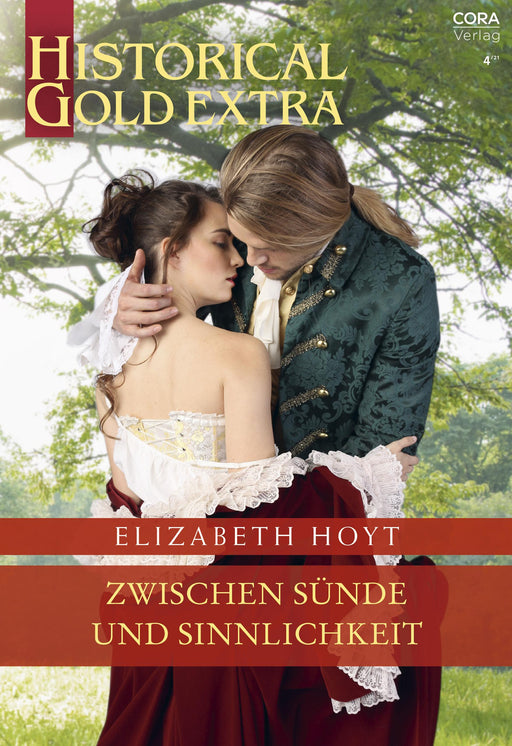Mitternacht mit dem Duke
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Bei Tag ist der berühmte Duke of Wakefield ein ehrbarer Adliger, bei Nacht ein maskierter Rächer, der für die Ärmsten der Armen kämpft. Niemand ahnt etwas von seinem wohlgehüteten Geheimnis, bis er bei einem seiner Streifzüge durch das nächtliche London die betörende Artemis vor einem brutalen Angreifer rettet. Nicht nur erhascht sie einen Blick hinter seine Maske, unerwartet trifft er sie bei Tag wieder. Eiskalt droht sie, ihn zu verraten - es sei denn, er hilft ihr, ihren Bruder aus dem Gefängnis zu befreien! Ein riskantes Vorhaben mit ungeahnt sinnlichen Folgen, die nicht nur sein Doppelleben, sondern auch sein Herz jäh in Gefahr bringen …